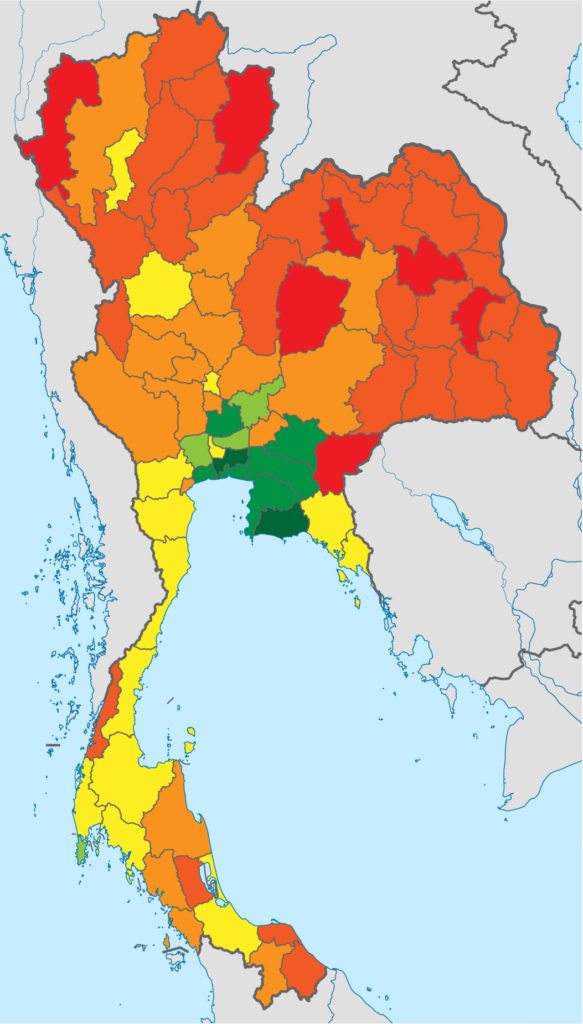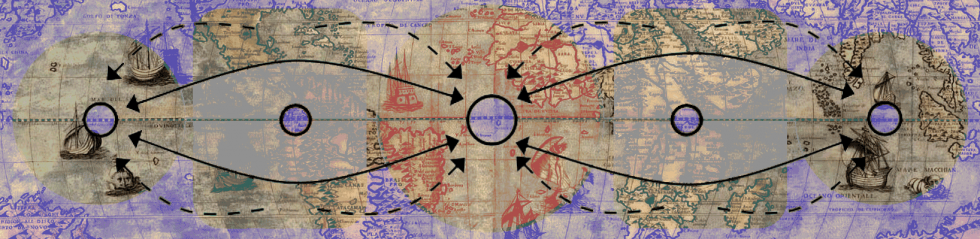Die Kriegsvorbereitungen in Deutschland laufen auf Hochtouren. Spätestens seit den aktuellen Diskussionen um aberwitzige Aufrüstungsprogramme in der BRD im Umfang von bis zu 900 Milliarden Euro, den deutsch-europäischen Bestrebungen endlich wieder Weltmacht zu werden und aus dem Schatten der USA heraus zu treten und den Diskussionen um einen direkten Krieg gegen Russland im Jahr 2029 ist das auch bei weiten Teilen der Bevölkerung angekommen. Nicht umsonst spielte das Thema bei Landtagswahlen im letzten Jahr eine große Rolle, sorgte unter anderem für den Einzug des Bündnis Sahra Wagenknecht in verschiedene Parlamente und auch bei den diesjährigen Bundestagswahlen war das Thema Krieg weit oben bei den Sorgen der Wähler*innen.
Das „Zukunftsforum öffentliche Sicherheit e.V.“ (ZOES e.V.), ein staatseigener, parteiübergreifender Thinktank der regelmäßig Denkschriften zur aktuellen Sicherheitsarchitektur und -lage in der BRD veröffentlicht, hat passend zur zunehmend militarisierten öffentlichen Meinung das „Grünbuch zivil-militärische Zusammenarbeit 4.0“ vorgelegt. Dort wird mit dem, freilich rein fiktiven, Szenario eines Truppenaufmarsches der NATO an der Ostflanke im Jahr 2030 geplant und daran die Herausforderungen für die bundesdeutsche Gesellschaft als Unterstützer:innen der Bundeswehr und der Gaststreitkräfte aus den NATO-Staaten diskutiert. Vor allem die Bereiche Gesundheitsversorgung, (kritische) Infrastruktur, Verwaltung und innere Sicherheit bekommen von den Verfasser:innen besondere Aufmerksamkeit.
Das Grünbuch analysiert die Ausgangslage für einen solchen Aufmarsch und seine Schwierigkeiten und soll Handlungsempfehlungen für die zukünftigen Regierenden zum Schließen vermeintlicher Lücken in der Sicherheitsarchitektur der BRD geben.
Die Zusammensetzung des Vorstands und die politische Linie seiner Publikationen zeigt den politischen Auftrag des „Zukunftsforums“: Neben Mitgliedern der Regierung sitzen Vertreter:innen der (Sicherheits-)Wirtschaft und ehemalige Militärs zusammen und erarbeiten Lösungen im Sinne einer möglichst umfassenden sozialen Kontrolle der Gesellschaft durch den Staat und seine Institutionen.
Gesundheitsversorgung
„Die zuverlässige Versorgung mit Leistungen des Gesundheitswesens ist für Militärangehörige und die Zivilbevölkerung ein wichtiger Faktor für deren Moral und Resilienz in Krisen und Konfliktfällen.“ (Grünbuch ZMZ 4.0, S. 32) – mit diesem Satz beginnt der Abschnitt zur Gesundheitsversorgung von Militär und Gesellschaft im Kriegsfall. Dass schon heute in Bezug auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, sowohl notfallmedizinisch als auch hausärztlich, ein gravierender Mangel in der BRD herrscht ist den Autor*innen durchaus bewusst und wird auch im Folgenden benannt, die Analyse der Gründe freilich werden außen vor gelassen. Stattdessen kommt dieser Mangellage die Aufmerksamkeit der Autor*innen nur aus einer militärischen Logik zu: wie kann eine Gesundheitsversorgung von Bundeswehr und Verbündeten im Kriegsfall garantiert werden? Wie kann der Bevölkerung vermittelt werden, dass die Versorgung verwundeter Soldat*innen Vorrang hat? Wie kann medizinisches Personal in der Versorgung Kriegsverletzter geschult werden?
Statt auf Versorgungslücken im Gesundheitssystem im Rahmen von Kriegsvorbereitungen zu verweisen, wäre eine ausreichende Finanzierung durch die öffentliche Hand unter demokratischer Kontrolle der Gesellschaft für die Bevölkerung eine dringende Notwendigkeit. Die Privatisierung der Krankenhäuser und ein elitäres Studiensystem im Bereich Medizin hat zu einer massiven Versorgungslücke geführt und das ist nicht erst seit der Corona-Pandemie offensichtlich. Der Verweis auf die Kapazitäten der USA im militärmedizinischen Bereich schaffen dabei weiterhin falsche Anreize. Schulungen medizinischen Personals sollten immer dem Wohle aller und auch international zugute kommen, dem sind Mediziner*innen weltweit schließlich verpflichtet. Statt das Training für die Versorgung von Kriegsverletzungen sollten die Bemühungen für dauerhaften Frieden und Abrüstung an erster Stelle stehen. Die Überlegungen, zivile Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz unter militärisches Kommando zu stellen, laufen außerdem den Grundsätzen der Hilfsorganisationen zuwider, wonach sie allen im Krieg versehrten Hilfe zukommen lassen müssen, nicht nur der jeweils „eigenen“ Seite.
Abschließend ist es an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten, wenn die Verfasser*innen den Regierenden zielgruppenspezifische Kommunikationsstrategien nahe legen um die Bevölkerung in ihrer Breite auf eine Mangellage im Kriegsfall vorzubereiten. Wie das aussehen könnte?: „Leider müssen wir Ihnen mitteilen dass ihre Mutter verstorben ist, das Bett ist für Soldat*innen reserviert die schnell gesund werden müssen um weiter zu kämpfen, aber Sie können stolz sein denn so haben sie einen Beitrag zur glaubhaften Abschreckung unsere gemeinsamen Feinde gemacht.“ Solche Kalkulationen mit Bereichen der allgemeinen Daseinsvorsorge sind in Zeiten in denen bereits eine akute Mangellage besteht mehr als zynisch und zeigen welches Geistes Kind die Autor*innen sind.
Innere Sicherheit
„Ein breit geführter gesellschaftlicher Diskurs über die Gefahren extremistischer Bestrebungen sowie eine erhöhte Sensibilität aufgeklärter Bürgerinnen und Bürger angesichts potenzieller Bedrohungen sind essenzielle Bestandteile einer wehrhaften Demokratie.“ (Grünbuch ZMZ 4.0, S.39).
Die herrschende Klasse geht, völlig zurecht, davon aus, dass im Falle eines umfassenden Krieges der Unmut in der Bevölkerung gegen die Kriegspolitik und die Präsenz des Militärs in den Straßen, samt Einschränkungen des öffentlichen Lebens, zu vermehrten Aktionen und Demonstrationen gegen den Krieg führen wird. Um diesem Problem vorzubeugen empfehlen die Autor*innen vor allem zweierlei: zum einen eine breit angelegte Kommunikationskampagne die auf eine formierte Gesellschaft abzielt („aufgeklärte Bürger*innen“), dass bedeutet allen soll klar sein wo der Feind im Inneren (links) und im Äußeren (Feinde des Wertewestens) steht, damit der Unmut über Mangellage und autoritäre Maßnahmen sich dementsprechend entladen kann.
Wenn das allerdings nicht ausreicht muss es dann eben doch die harte Hand des Staates richten gegen alle die den öffentlichen Frieden, also Truppen- und Materialtransport an die Front über öffentliche Infrastruktur oder die Einberufung Wehrpflichtiger, stören. Deshalb soll parallel zur Homogenisierung der öffentlichen Meinung wie wir es schon im Rahmen des Krieges in Gaza oder der Ukraine bestaunen durften die sogenannten Sicherheitsbehörden massiv aufgerüstet werden. Das bedeutet mehr Befugnisse für den skandalumwitterten Verfassungsschutz samt partieller Aufhebung des Trennungsgebots zwischen Geheimdiensten und Polizeien zur „besseren Informationsweitergabe“, eine Aufstockung der Kapazitäten der (Bundes-)Polizei samt erhöhter Präsenz auf den Straßen und der Einsatz des Militärs zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben. Proteste dagegen begegnen den Autor*innen dabei immer nur als Folge einer Einflussnahme von außen, dass die Menschen schon jetzt von maroder Infrastruktur, Repression und eingeschränkter Versorgung die Schnauze voll haben kommt in einer „formierten Gesellschaft“ eben nicht vor.
Fazit und Ausblick
Die Probleme der Gesellschaft, wie die Unterfinanzierung von Bereichen des Allgemeinwohls, aus der Perspektive des Militärs und des Krieges zu analysieren, instrumentalisiert die realen Ängste der Menschen. Es verstellt den Blick auf die Ursachen, nämlich das kapitalistische Wirtschaftssystem und die imperialistische Politik der herrschenden Klasse. Nach einem durch Profitlogik kaputtgesparten Gesundheitssystem oder maroder Infrastruktur durch gekürzte öffentliche Ausgaben fragt dann keiner mehr. Diese Probleme unter denen die Bevölkerung seit Jahren und Jahrzehnten leidet werden von den Verfasser*innen im eigenen Interesse analysiert und sollen im Interesse der Herrschenden und auf Kosten der Allgemeinheit gleichsam gelöst werden. Die bedarfsgerechte und langfristige Deckung der Grundbedürfnisse der Gesellschaft in den Bereichen öffentliche Daseinsvorsorge, Nahrung oder Wohnraum kommt dabei nicht vor, kriegstüchtig muss das Land sein und die Menschen sind dabei nur Objekt von Kommunikatiionsstrategien und Risikokalkulationen.
Um einen Krieg zu verhindern müssen die Grundlagen der kriegerischen Auseinandersetzungen in einem multipolaren Weltsystem beseitigt werden: die Konkurrenz der Monopole und der sie vertretenden Nationalstaaten um Rohstoffe, Handels- und Energierouten. Die Kriege der herrschenden Klasse gehen immer zu Lasten der Allgemeinheit und sind nur möglich durch die Mobilisierung reaktionärer Denk- und Verhaltensmuster. Um einer Militarisierung im Hier und Jetzt Einhalt zu gebieten braucht es eine Offensive gegen Wehrpflicht und Sondervermögen, für einen Ausbau diplomatischer Bemühungen um eine atomare Auseinandersetzung zu verhindern und ein Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge in den Bereichen Zivilschutz, Ernährung und Wohnen um rechten Einstellungen den Boden zu entziehen. Die Linke in Deutschland darf nicht wieder den Fehler machen und in das Kriegsgeheul der Herrschenden einstimmen, wenn sie sich als glaubhafte Alternative präsentieren will sondern muss die Kriegsvorbereitungen denunzieren und angreifen denn ihre Kriege sind nicht unsere Kriege, ihr Frieden nicht unser Frieden!
Foto: Twitter/ThatSimplePanda