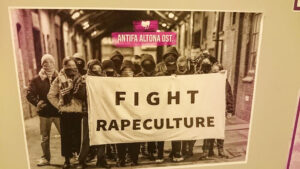Die Corona-Pandemie hat Gesundheitsbereich wie Gesellschaft insgesamt zu einem Pulverfass werden lassen. Ausbaden müssen die enormen Mehrbelastungen unter anderem die Arbeiter:innen im Gesundheitssektor, die öffentlich beklatscht und zugleich verheizt werden. In Hamburg ist nun deshalb ein Arbeitskampf ausgebrochen. Unsere Autorin Lena Padberg ist examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Hamburg, politisch innerhalb und außerhalb gewerkschaftlicher Zusammenhänge aktiv.
Sie will den Leser:innen einen Einblick hinter die Kulissen der Hamburger Krankenhäuser gewähren und über den Widerstand der Beschäftigten gegen die Profitinteressen der Klinikaktionäre berichten.
Insbesondere der Gesundheitssektor, der schon vor der Corona-Krise am Limit war, musste in den letzten Monaten eine nie dagewesene Krise unter menschenunwürdigsten Arbeitsbedingungen bewältigen.
Die Pandemie trifft auf absoluten Personalmangel in allen Bereichen. Die Organisation in den Kliniken ist in vielen Krankenhäusern mehr auf Gewinnmaximierung als auf sinnvolles Handeln im Sinne der Gesundheit der Patient:innen ausgerichtet. Unterbesetzung, Fallpauschalen in Krankenhäusern, Zeitvorgaben in der Pflege und Patient:innen als „Gewinnfaktor“ dominieren weiterhin die Versorgung in Hamburger Krankenhäuser. Die angekündigten Pflegebonuszahlungen sind bislang nicht ausgezahlt worden und werden auch nie ausgezahlt werden. Der Personalmangel ist an seinem absoluten Höhepunkt angekommen, unter anderem aufgrund der Aussetzung der Personaluntergrenzen.
Zweite Welle: Völlig überlastet
Zum Vergleich ist anzumerken, das in der ersten Pandemiewelle im Frühjahr ganze Abteilungen im Krankenhaus für Coronapatient:innen frei gemacht werden konnten. Kliniken erhielten Finanzspritzen und Personal aus der Anästhesie und den Operationssälen wurde auf die Intensivstation verlegt. Es gab Schulungen für Beatmungsgeräte, ein Krisenmanagement und vieles mehr.
In der zweiten Welle gibt es davon nichts mehr.
Kein Bett wird für Corona freigehalten, Anästhesiepersonal hilft nicht auf den Intensivstationen aus, kein Krisenmanagement ist vorhanden und Stationen, die für Corona geplant waren, wurden im September sogar geschlossen. Gleichzeitig haben einige Krankenhäuser sogar Personal im Bereich des Services (Versorgung der Patient*innen mit Essen usw.) abgebaut – und diese Tätigkeit muss nun vom Pflegepersonal übernommen werden.
Die geplanten Krankenhausbetten für Corona-Patient*innen sind in Hamburg weitestgehend belegt. Drastische Folge dessen ist, dass Coronapatient*innen auf allen Stationen verweilen. Dies hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich die anderen Patient*innen über das Personal mit Corona infizierten.
Zudem werden Patient*innen weiterhin regelmäßig auf den Fluren der Krankenhäuser geparkt.
Diese Zustände führten dazu, dass es in den letzten Wochen zu massiven Corona-Ausbrüchen unter dem Personal und den Patient*innen in den Hamburger Krankenhäusern gekommen ist.
Es ist kein Geheimnis, dass für medizinisches Personal andere Quarantäne-Vorschriften gelten.
Personal in “Freizeitquarantäne”
Quarantäne bedeutet für das Gesundheitspersonal nämlich eigentlich Freizeitquarantäne. Verboten ist alles, außer das Verlassen des eigenen Zuhause zum Arbeiten. Alles andere – wie zum Beispiel das Wegbringen der eigenen Kinder in den Kindergarten und das Einkaufen usw. – ist nicht erlaubt. Zudem ist es verboten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren. Was das für die Gesundheitsbeschäftigten bedeutet, kann sich jeder selbst ausmalen.
Außerdem stellen die knappen Ressourcen der Gesundheitsämter ein großes Problem dar. Oftmals kommen sie mit der Kontakt-Verfolgung innerhalb der Krankenhäuser nicht mehr hinterher. Dies nutzen die Klinikbetreiber aus, denn solange den Krankenhäusern keine staatliche Quarantäneauflagen für ihr Personal vorliegen, müssen alle weiterarbeiten. Gleichzeitig bekommen einige Pflegekräfte auch Arbeitsverbote (Also richtige Quarantäne). Dies führt wiederum dazu, dass manchmal ganze Stationen bis hin zu Abteilungen kein Personal mehr hatten, um die Patient*innen zu versorgen. Ab diesem Moment wird Personal von anderen Stationen abgezogen, das wiederum dort fehlt, ein Teufelskreis.
Um all den Personalmangel zu kompensieren, kamen die Verantwortlichen in Niedersachsen auf die Idee, die 60 Stunden Woche und den 12 Stunden Tag für die Beschäftigten aus dem Krankenhaus zu ermöglichen. Dieses führt dazu, dass die Kliniken auch in anderen Bundesländern versuchen, Lockerungen des Arbeitszeitgesetzes durchzusetzen.
Schutzkleidung Mangelware
Schutzkleidung ist – wie schon in der ersten Welle – weiterhin Mangelware und deren Qualität ist mehr als nur unzureichend, sie ist miserabel. Die Klinikbetreiber geben sogar vor, dass der Mundschutz nur bei enormer Verschmutzung, nach einer Schicht oder sogar erst nach einer Woche gewechselt werden darf. Dass der medizinische Mund-Nasenschutz laut Herstellerangaben aber niemals eine so lange Wirksamkeit garantiert, wird vernachlässigt. Manche Kliniken geben Schutzkleidung sogar nur rationiert raus, sodass die Kolleg*innen keine andere Wahl haben, als den Mundschutz für 8 Stunden oder länger zu tragen.
Das gesamte Klinikpersonal wird immer noch nicht großflächig getestet. Pflegekräfte müssen um Coronatests betteln und dann noch bestimmte Kriterien erfüllen, um einen Test zu bekommen.Das Testergebnis aber spielt in vielen Fällen aber sowieso keine Rolle, da egal, ob negativ oder positiv, die Arbeit weitergeführt werden muss. Also halten wir fest: Für den Fußball gibt es den Test. Für das Personal im Krankenhaus gibt es Ausbeutung bis zum Umfallen.
Pfleger:innen vor dem Zusammenbruch
Elektive medizinische Eingriffe – also nicht unaufschiebbare Operationen – wurden in der ersten Welle noch ausgesetzt. Jetzt aber werden so viele Patient*innen wie möglich durch die Krankenhausfabrik geschleudert, damit die Klinikmanager und die Aktionäre sich an dem Leiden und an der Pandemie bereichern können.
Die Angst davor, sich mit Corona zu infizieren, sowie die psychische und körperliche Belastung aufgrund der menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen im Krankenhaus, ist in vielen Fällen aktuell so groß, dass sich Pfleger:innen wochenlang krankschreiben lassen und das emotionale Ausbrüche, wie zum Beispiel das plötzliche Zusammensacken des Körpers oder panisches Schreien, Wutanfälle und heftiges Weinen unter uns Beschäftigten im Gesundheitswesen zu einer Alltäglichkeit geworden sind. Diese Ängste sind nicht unberechtigt, einige Krankenhausbeschäftigte liegen nun in dem Bett und an der Beatmungsmaschine, die sie zuvor selbst betreut haben.
Ein Arbeitskampf beginnt
Im Jahr 2019 wurde der sogenannte Volksentscheid für mehr Personal im Krankenhaus vom Hamburger Senat als verfassungswidrig eingestuft. Ein Grund lag darin, dass auf Bundesebene eine Personalregelung schon verabschiedet worden sei, nämlich die am Ist-Zustand orientierende Personaluntergrenzen. Diese haben in der Vergangenheit zu Personalabbau, dauerhaften Patient*innen-Verschiebungen geführt und ganze Stationen wurden einfach umbenannt, damit sie nicht in die Personaluntergrenzenregelung hereinfallen.
Während das Verfahren gegen den Volksentscheid lief, hatten sich schon längst viele Beschäftigte aus den Krankenhäusern organisiert. Es fanden sich Pfleger:innen, Hebammen, Therapeut:innen usw. zusammen. All diese hatten schon lange die Idee von der Organisierung „von unten“, also der eigenen Kolleg:innen. Es wurden alte und neue Arbeitskämpfe aufgearbeitet, aus denen sich die theoretische Grundlage für die Praxis gebildet hatte.
In den darauf folgenden Monaten wurden in den Krankenhäusern immer mehr Kolleg:innen dazugewonnen. Gleichzeitig kam es zu mehreren Veranstaltungen, in denen gemeinsam der Inhalt der Forderungen ausdiskutiert worden ist. Denn nur die Kolleg:innen selbst wissen, was es braucht, um die Arbeit und die Versorgung im Krankenhaus menschenwürdiger zu machen.
Kurz darauf standen schon die Hamburger Senatswahlen an.
Wir wollten die Wahlen bestimmen und das Thema Pflegenotstand zurück in den Wahlkampf bringen. Dies war von der politischen Seite nicht erwünscht. Jedoch waren die Krankenhausbeschäftigten unermüdlich. Zunächst gab es eine Unterschriftenaktion, die dem Senat überreicht worden ist, danach eine Fotoaktion, Besuche von Pfleger:innen in den Wahlkampfveranstaltungen, Demonstrationen und zum Schluss eine Anhörung, in der z.B. auch Frau Fegebank, Vorsitzende der Grünen, teilnahm. In der Anhörung hatten die Beschäftigten des Krankenhauses ihren Klinikalltag und ihre Forderungen geschildert. Diese Aktionsform, sowie all die anderen Aktivitäten, haben dazu geführt, dass die Kolleg*innen einen großen Erfolg erleben konnten.
Am Anfang des Jahres 2020, noch vor dem Beginn der Pandemie, ließ die Gesundheitsbehörde berichten, dass vier große Forderungen von den Krankenhaus-Beschäftigten ins Koalitionsprogramm aufgenommen worden sind.
Die vier Koalitionspunkte enthalten sinngemäß:
- Keine Hebamme soll mehrere Geburten gleichzeitig betreuen;
- Keine Pflegekraft soll alleine im Nachtdienst für über 30 Patient:innen zuständig;
- Einführung einer Personalbemessung;
- Auszubildende erhalten eine dauerhafte Praxisbetreuung
Viele von diesen Aktionen hatten natürlich ihren Zweck darin, das Thema Krankenhaus in die Öffentlichkeit zu bringen. Dennoch haben uns am Ende nicht die Unterschriften interessiert, sondern die Kolleg:innen, die hinter ihnen stehen. Der eigentliche Zweck lag nämlich darin, Strukturen aufzubauen. Denn je größer der Organisationsgrad, desto schwieriger die Aktionen. Dabei ist der größte Strukturtest am Ende der Streik.
Tarifrunde und Arbeitsstreiks
Im Laufe des Jahres wurden mehrere Umfragen, Fotoaktionen, Pressekonferenzen usw. durchgeführt. Nachdem die erste Coronawelle abgeflacht war, ging es erst richtig los.
Die Tarifrunde wurde gestartet.
Hamburg hatte aufgrund der effektiven Organisation in der Vergangenheit einen leichten und guten Start in die Tarifrunde. Erstmals wurde mit der Gewerkschaft und der organisierten Basis neue Methoden des Arbeitskampfes ausprobiert. Dies beinhaltet zum Beispiel die Durchführung von „Arbeitsstreiks“, regelmäßig Treffen, direkte Absprachen mit der Tarifkommission und einer hohen Teilnehmer:innenzahl bei den beiden durchgeführten Warnstreiks.
Trotz des ernüchternden Tarifergebnisses müssen sich Linke und die Beschäftigten vor Augen führen, dass in früheren Tarifrunden meistens pro Krankenhaus nicht Mal hundert Menschen die Arbeit niedergelegt hatten. Diese Tarifrunde aber haben sogar 350 Kolleg:innen nur an einem Krankenhaus gestreikt und insgesamt 3500. Gleichzeitig hat die Tarifrunde den gewerkschaftlichen und außer-gewerkschaftlichen Organisationsgrad in den Krankenhäusern enorm erhöht. Die Warnstreiks in der letzten Tarifrunde haben damit ein großes Potenzial innerhalb der Arbeiter*innenklasse gezeigt.
Es war nie unser Ziel, diese lächerlichen 4,5 Prozent zu erhalten. Es war verständlich, dass am Ende der Tarifrunde einige Kolleg*innen über das Ergebnis enttäuscht waren. Zudem hatte die Gewerkschaft in Hamburg wieder einmal gezeigt, wie eng sie mit der arbeiter*innenfeindlichen Sozialdemokratie zusammenarbeitet. Trotzdem haben die meisten den wahren Erfolg erkannt und wissen, dass es nicht unser Ziel war, die Gewerkschaftsforderungen durchzusetzen, sondern eben die Organisierung von unten.
Schwierigkeiten im Arbeitskampf
Es ist natürlich zu vermerken, dass die Organisation von Beschäftigten in der aktuellen Zeit eindeutig mehr Feingefühl benötigt. Es mussten immer wieder Veränderungen innerhalb der Strategie vorgenommen werden. Zusammenkünfte mussten ins Virtuelle verlagert werden. Ausfälle von Organizer*innen und Aktivist*innen mussten kompensiert werden. Es ist ein dauerhaftes Auf und Ab in den letzten Monaten gewesen, jedoch konnten wir durch die sich stetig veränderten Situationen auch neue Wege der Organisation von Krankenhausbeschäftigten erlernen, die uns ohne Pandemie nicht gegeben wären.
Gleichzeitig scheint es aktuell so zu sein, dass je schlimmer die Arbeitsbedingungen durch Corona und den bestehenden Personalnotstand werden, desto schwieriger der Arbeitskampf wird. Es wird davon ausgegangen, dass im Dezember die letzte Chance für uns Beschäftigten im Krankenhauswesen liegt, um den Arbeitskampf in einer noch höheren Phase führen zu können. Danach wird es wahrscheinlich erschwert sein, den Arbeitskampf weiterzuführen, da die Lage im Gesundheitswesen aller Wahrscheinlichkeit nach eskalieren wird.
Derzeit wird versucht, die Politik in die Verantwortung zu nehmen. Des Weiteren sind noch andere Aktionen und Wege geplant, die jedoch natürlich aus strategischen Gründen nicht beschrieben werden. Dennoch kann man festhalten, dass auch Streiks in dieser Zeit als eine Option und nicht nur als eine Option angesehen werden, sondern als eine Notwendigkeit. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass es zu spontanen Kampfmaßnahmen in den Krankenhäusern kommt. Dergleichen gab es z.B. schon im Jahre 2019 in einem Operationssaal, als die OP-Pfleger*innen sich an einem Morgen in den Sitzstreik begeben hatten.
Repressionen: Ausprägung und Folgen
Repressionen waren und sind im Arbeitskampf der Krankenhäuser auf der Tagesordnung. Mal kommt es zu Versuchen, Unterschriftenlisten oder andere Dokumente in den Kliniken von Aktivist*innen einzuziehen oder diese durch den Arbeitgeber zu entwenden. Es kommt zur Ausübung von psychischem Druck über die Ärzteschaft und durch Personalgespräche. Die meisten Repressionen bestanden aus: Zwangsversetzungen von Pflegekräften auf andere Stationen, Abmahnungen, Kündigungsandrohungen, Teamtrennungen und Arbeitsverpflichtungen vor den Streiks.
Zudem versuchte die Arbeitgeberseite in der Corona-Krise, die Öffentlichkeit auf ihre Seite zu bekommen, damit die gesellschaftliche öffentliche Meinung sich gegen die Streikenden in den Krankenhäusern richtet. Es wurde auf hetzerische Weise in den sozialen Medien, Zeitungen usw. die Streiks, als eine Gefahr für die Versorgung von Patient*innen dargestellt.
Doch die Streikenden konnten mit einer hervorragenden Community-Arbeit, die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass nicht der Streik, die Versorgung in deutschen Krankenhäusern verschlechtert, sondern der Normalzustand des Personalnotstands.
All diese Repressionen haben uns gelehrt, das die bestehende Solidarität, die wir in den letzten Jahren durch die Organisation aufbauen konnten, unsere größte Waffe gegenüber der Kapitalseite ist. Jedoch hat auch konsequente Antirepressionsarbeit im voraus eine zentrale Rolle gespielt. Denn wer seine Rechte kennt, kann sich besser wehren.