2022 wird, glaubt man den Kommentatoren aus Handel, Industrie und Forschung, ein Jahr der „Knappheit“. Die Engpässe in globalen Lieferketten werden bleiben, mit „einer schnellen Entspannung sei nicht zu rechnen“, warnt der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm. Die Stockungen betreffen alle Bereiche des wirtschaftlichen Lebens, von Rohstoffen über Halbfrabrikate bis zu Lebensmitteln. Die Lieferengpässe seien in Deutschland inzwischen „Alltag“, erklärt auch REWE-Chefmanager Lionel Souque. „In vielen Wochen werden zurzeit von der Industrie weniger als 90 Prozent der bestellten Lebensmittel geliefert. Das ist völlig ungewöhnlich und teilweise inakzeptabel“, sagte er.
Die Krise in den Lieferketten macht sichtbar, was in Zeiten des reibungslosen Ablaufes im Hintergrund bleibt. Die meisten Waren, die in den westlichen Zentren des Kapitalismus konsumiert werden, haben weite Reisen zurückgelegt. Der Kaffee aus Brasilien, die T-Shirts aus Bangladesch, die Schuhe aus der Dominikanischen Republik, die Smartphones aus China und Indien, die Auto-Bestandteile aus Südafrika – sie alle sind fester Bestandteil eines Systems, in dem sich die herrschenden Klassen einiger weniger Nationen die Arbeitskraft und Ressourcen des gesamten Planeten aneignen.
Die Internationalisierung der Produktion in weltumspannenden Warenketten hat spätestens seit den 1980er-Jahren zu einer neuen Phase in dem geführt, was marxistische Theoretiker:innen seit der Wende zum 20. Jahrhundert „Imperialismus“ nannten. Viel deutschsprachige Literatur gibt es leider zur neueren Imperialismusforschung nicht. Deshalb soll es im folgenden um einige Bücher internationaler Marxist:innen gehen, die genau hier ansetzen und Imperialismusanalysen entwickeln, die in erster Linie von dieser globalen Produktionsweise ausgehen: John Smith („Imperialism in the twenty-first century. Globalization, Super-Exploitation and Capitalism‘s Final Crisis“) und Intan Suwandi („Value Chains. The New Economic Imperialism“) kommen aus dem Umfeld der Zeitschrift „monthly review“, für die einst Albert Einstein sein Essay „Why Socialsm?“ schrieb und die später einflussreiche Antiimperialist:innen wie Samir Amin hervorbrachte. Torkil Lauesen („The Global Perspective. Reflections on Imperialsm and Resistance“) war Mitglied der antiimperialistischen militanten Gruppe „Blekingegade-Bande“,die aus einer maoistischen Tradition kommend spektakuläre Überfälle in Dänemark durchführte, deren Erlös an Befreiungsbewegungen im Trikont ging.
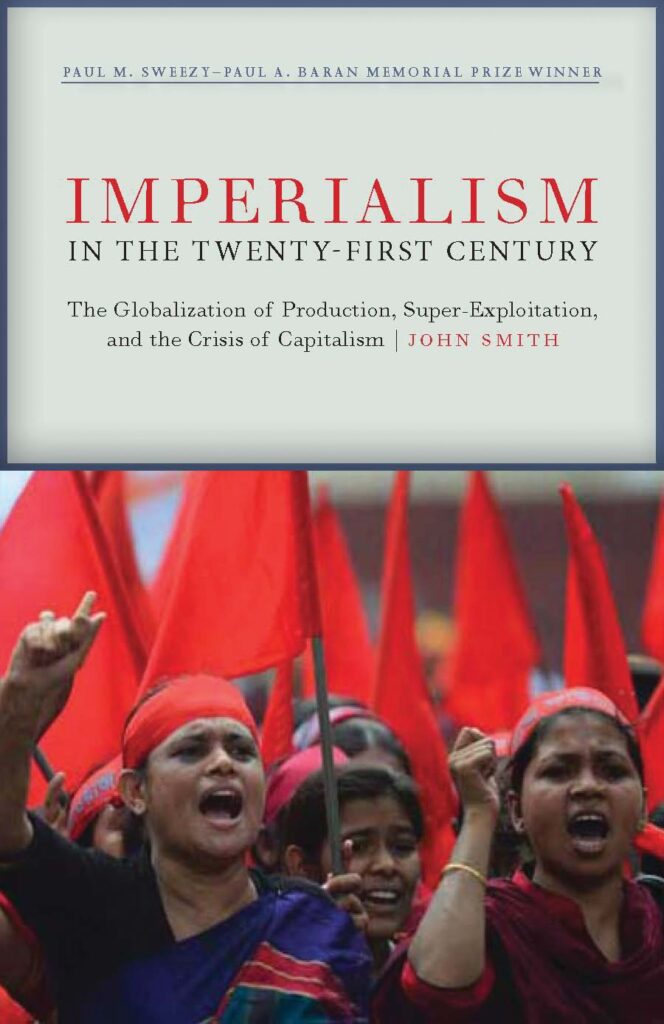
Imperialismus und Globale Warenketten
Im alltäglichen Sprachgebrauch findet „Imperialismus“ statt, wenn eine Nation sich militärisch auf das Territorium einer anderen Nation ausdehnen will. Auch für Marxist:innen spielte Krieg stets eine wichtige Rolle für den Imperialismusbegriff – allerdings als Symptom, nicht als erstes Wesensmerkmal. „Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen“, formulierte einst der französische Sozialist Jean Jaures. Und Revolutionär:innen wie Rosa Luxemburg, W.I. Lenin oder Nikolaj Ivanovic Bucharin ging es in erster Linie darum, zu verstehen, wie die Wolke beschaffen ist, dass sie überhaupt zum Regen führt.
Würde man eine möglichst kurze „Definition“ von Imperialismus in dieser Tradition geben wollen, bietet sich eine Formulierung an, die John Smith kürzlich in einem Interview gebraucht hat: „Die konziseste und konkreteste Definition von Imperialismus, die mir in den Sinn kommt, ist die Unterordnung der gesamten Welt unter die Interessen der herrschenden kapitalistischen Klassen aus einer Hand voll Unterdrückernationen.“
Bleibt diese Formulierung zwar für alle Phasen des Imperialismus gleich, so änderten sich seit Lenins Zeiten doch auch fundamentale Eigenschaften des Systems, wie sich die in den imperialistischen Nationen ihre Basis habenden herrschenden Klassen den aus aller Welt abgeschöpften Surplus aneignen. Seit der formalen Dekolinialisierung hat sich die globale Arbeitsteilung drastisch verändert.
Als die beiden Ökonomen Hans Wolfgang Singer und Raul Prebisch im Jahr 1949 ihre These entwickelten, dass die Verschlechterung der „terms of trade“ für die abhängigen Nationen aus dem Umstand resultieren, dass sie vor allem Rohstoffe und Agrargüter in den Weltmarkt einbrachten, konnte man noch die Hoffnung hegen, eine nachholende Industrialisierung würde diese Länder aus dem Joch der „Unterentwicklung“ befreien. Doch diese ist zumindest in einigen Ländern der Peripherie längst eingetreten – und dennoch blieb der Globale Süden abhängig, „unterentwickelt“ und verarmt. Woran liegt das?
John Smith und Intant Suwandi sehen den wesentlichen Punkt in der gegenwärtigen imperialistischen Produktionsweise in Globalen Warenketten, deren Knotenpunkte dazu dienen, dem Proletariat im Globalen Süden per „Super-Exploitation“ Mehrwert abzupressen und ihn in die Zentren zu schaffen. In diesen Zentren sind es einige Zehntausend Mulitnationaler Konzerne, die an der Spitze der jeweiligen Ketten von Zulieferern stehen und die direkt – per Ausländische Direktinvestition – oder indirekt – per amrs lenght contracts – bestimmen, was, wie und wieviel produziert wird.
Am „unteren“ Ende der Warenketten stehen die bis aufs Blut ausgebeuteten Arbeiter:innen der Peripherie, die in endlosen Schichten zu niedrigsten Löhnen in den Produktionsablauf eingespeist werden, die Sweatshops der Textilfabrikanten genauso wie die Assembly Lines der Smartphone-Hersteller. Am oberen Ende die Eigentümer und das Management der Multis samt ihrer Marketing-, Forschungs- und Brandingabteilungen in den imperialistischen Zentren.
Globale Warenketten
„Outsourcing“ und „Offshoring“ sind – diese These ist der Kern der Theorien von Suwandi und Smith – Symptome der Suche nach billigeren Lohnstückkosten. Diese Ausnutzung der „Arbitrage“ von Arbeitskosten (global labor arbitrage) motiviert die Verlagerung großer Teile der Produktion aus den Zentren in ausgewählte Länder der Peripherie. Der „fundamentale Treiber und Formgeber der Globalisierung“ sei die „global labor arbitrage, die Ersetzung von Arbeitern mit relativ hohen Löhnen in imperialistischen Zentren durch Niedriglohnarbeiter in China, Bangladesch und anderen Nationen des Globalen Südens“, konstatiert Smith (S188). Die marxistische Theorie müsse auf diese Neuerung mit einer „Werttheorie des Imperialismus“ antworten, die in Rechnung stellt, dass zusätzlich der beiden von Marx ausführlich analysierten Arten der Erhöhung des relativen und absoluten Mehrwerts auch eine dritte, vom Autor des Kapital angedeutete Form der Maximierung der Mehrwertrate eine immer größere Rolle spielt, die auf „Überausbeutung“ basiert – dem Versuch des Kapitals, die Ware Arbeitskraft unter ihren Wert zu drücken.
Smith und Suwandi wissen, dass es gegen diese Theorie in den früheren Auseinandersetzungen zwischen Dependenztheorie und „orthodoxem“ Marxismus gewichtige werttheoretische Einwände gab. Doch es gelingt ihnen, sie sowohl auf Basis der Marxschen Theorie wie auch empirisch zu widerlegen – insbesondere die alte Mär, dass der Lohnunterschied zwischen Zentrum und Peripherie schlichtweg die Widerspiegelung von unterschiedlichen Produktivitätsniveaus sei. „Die deutlich höheren Ausbeutungsraten der Arbeiter im Globalen Süden haben nicht einfach mit niedrigen Löhnen zu tun, sondern auch mit dem Fakt, dass die Lohnunterschiede zwischen Nord und Süd größer sind als die Unterschiede in der Produktivität“, so Suwandi (S.59).
Smith verabschiedet sich aber zugleich auch von Vorstellungen, der Werttransfer ließe sich ausschließlich als „Monopolrente“ begreifen – viel mehr gehe es um ein „Konzept, dass das ökonomisch wesentliche – Monopolkapitalismus – mit dem politisch Wesentlichen – der Teilung der Erde in unterdrückte und Unterdrückernationen – vereint und beides in Begriffen der von Marx in seinem Hauptwerk Das Kapital entwickelten Werttheorie erklären vermag.“
Den Transfer von Mehrwert dabei tatsächlich empirisch nachzuverfolgen, ist nicht immer einfach: Die Rahmentheorien von bürgerlichen Statistiken taugen dazu nur beschränkt. Das „Bruttoinlandsprodukt“ etwa, so bemängeln beide Autor:innen, sei etwa keineswegs ein zureichender Maßstab der produktiven Leistungen einer Volkswirtschaft. Es bezeichne in Wahrheit nicht „value added“, sondern eher schon „value captured“, sei also eher ein Indikator dafür, wie viel Wert in einer Nation angeeignet, nicht produziert werde. Sieht man sich etwa die – gut erforschte – Wertkette eines Nokia-Smartphones an, so erscheint der überwiegende Teil von „value added“ als Leistung des Mutterkonzerns – und damit des Landes, in dem sich dessen Firmensitz befindet -, selbst wenn die Teile und die Endproduktion des physischen Geräts „Smartphone“ in Asien oder anderswo stattfinden.
Die Werttransfers sind zudem nicht immer offen sichtbar. Werden bei ausländischen Direktinvestitionen die Profite zumindest teilweise noch ausweisbar ins Mutterland rückgeführt, so bleiben bei „arms length contracts“ die Ausbeutungs- und Machtverhältnisse hinter Ketten von Äquivalententausch unsichtbar. Gerade diese allerdings werden in den Produktionsketten immer relevanter: Apple produziert kein Iphone selbst, Nike keinen Schuh. Das machen Zulieferer, die im Konkurrenzkampf um die Gnade der Multis ihre Arbeiter:innen so preiswert wir möglich auf den Weltmarkt werfen.
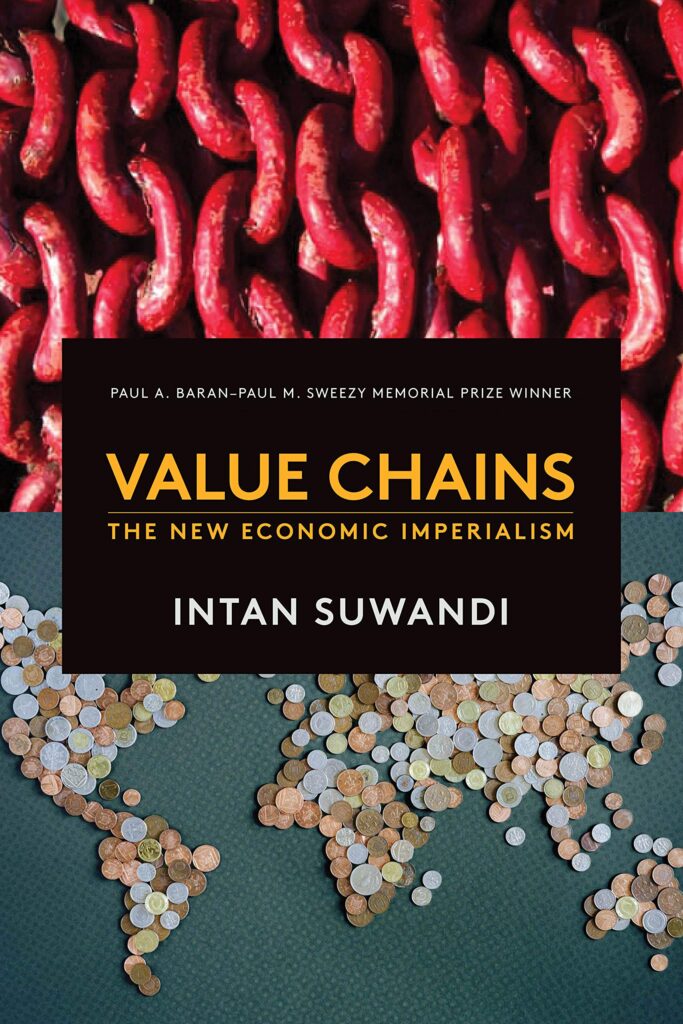
Globale Klasse, gespaltene Klasse
Die Notwendigkeit einer „Werttheorie des Imperialismus“ ist angesichts der globalen Klassenrealität keine theoretische Spielerei. Das Gros des Industrieproletariats lebt schon heute in den Nationen des Globalen Südens. Rechnet man die im „informellen Sektor“, der globalen „Slum-Ökonomie“, dahindarbenden, aber oft genug in die Wertketten des Kapitals eingebundenen Proletarier:innen sowie die Kleinbäuer:innen dazu, sehen wir eine aus Milliarden Menschen bestehende Masse unter der Knute des Imperialismus.
Ohne eine internationale Verbindung von deren Kämpfen mit denen in den Metropolen wird keine Befreiung möglich sein. Doch der Haken ist: Die Interessen dieser Teile der Klasse und zumindest der „privilegierteren“ Schicht von Arbeiter:innen in den imperialistischen Zentren sind nicht einfach deckungsgleich. Schon Lenin sprach von einer „kleinen Schicht“ der „Arbeiteraristokratie“ in den entwickelten imperialistischen Zentren, die von „ihrem“ nationalen Kapital mit Krümeln gefüttert werden, um den nationalen Klassenfrieden gegen den äußeren und inneren Feind zu sichern. Diese Arbeiteraristokratie bildete die potentielle soziale Basis von Opportunismus und Sozialchauvinismus, modern gesprochen: Der „Sozialpartnerschaft“ für den kapitalistischen Standort.
Torkil Lauesen und die aus dem „Kommunistischen Arbeitskreis“ in Dänemark hervorgegangene Theorietradition des „Schmarotzerstaats“ überspitzten nun in den 1970er-Jahren diese These im Eindruck der Nachkriegsphase des Klassenkompromisses bis zu der Schlussfolgerung: Eigentlich sind in den Metropolen gar keine revolutionären Klassenkämpfe mehr möglich oder zu erwarten, solange nicht der stetige Zufluss von Monopolprofiten aus dem Trikont abgerissen ist. Ergo: Die Praxis verschob sich von lokalen Kämpfen zu Unterstützungsaktionen für Kämpfe anderswo.
In seinem aktuellen Buch vertritt Lauesen diese These nicht mehr in dieser Form, bleibt aber bei der Betonung der Relevanz, die „Arbeiteraristokratie“ in die aktuellen Klassenanalysen einzubeziehen: „Eine Reihe von Faktoren binden die Interessen der Arbeiterklassen des Nordens an die des Globalen Kapitals. Die Superprofite der transnationalen Konzerne aus Investitionen im Globalen Süden ermöglichen es ihnen, relativ hohe Löhne im Globalen Norden zu zahlen, die Arbeiter dort mit einer signifikanten Kaufkraft ausstattet. (…) Gleichzeitig halten die Niedriglöhne des Globalen Südens die Preise für Konsumgüter relativ niedrig.“ Wenngleich Lauesen auch eingesteht, dass sich seit der Aufkündigung des Klassenfriedens durch die „neoliberale“ Offensive auch in den Metropolen die Kämpfe verschärfen, bleibt er bei der These: Die aus dem globalen System der Ausbeutung entspringenden Profite sind die Bedingung der Möglichkeit, sich einen (relativen) Klassenfrieden in den imperialistischen Metropolen zu erkaufen.
Notwendiger Antiimperialismus
Aus einer einigermaßen ausgearbeiteten Theorie des Imperialismus erwächst auch die Möglichkeit, die gängigen Debatten des „progressiven Neoliberalismus“ besser einzuordnen und die bürgerlichen Spielarten von Antirassismus und Feminismus besser von den proletarischen zu unterscheiden.
So spielen etwa nationale Grenzen eine zentrale Rolle in der Theorie der „global labor arbitrage“. Sie sind jene Schranke, die die überausgebeutete Klasse nicht überschreiten kann : „Während die Arbeitskraft nach wie vor durch das Migrationsregime in nationale Grenzen eingeschlossen ist, können das globale Kapital und die Waren sich weitaus freier bewegen – zunehmend noch durch die in den vergangenen Jahren durchgesetzte Liberalisierung des Handels“, schreibt Suwandi (S53). Die Grenzen sind so eingerichtet, dass sie die große Masse des globalen Proletariats da halten, wo es „hingehört“ und damit die Möglichkeit der höheren Mehrwertraten in der Peripherie garantieren. Gleichzeitig sind sie aber durchlässig genug, um billigere, migrantische Arbeitskraft (so weit sie nötig ist) in die Metropolen durchzulassen. Die Millionen „undocumented workers“ in den USA spielen dabei genauso eine wichtige Rolle für das imperialistische Geschäftsmodell wie die immer Wanderarbeiter aus Osteuropa und die immer noch deutlich schlechter verdienenden Arbeiter:innen mit „Migrationshintergrund“ in Deutschland. Die systematische Abwertung des Werts der Ware Arbeitskraft im Hinblick auf „migrantische“ Werktätige oder das Proletariat in der Peripherie bildet zugleich die Grundlage des Rassismus – und nicht der „schlechte Charakter“ von ungebildeten Weißen in den Zentren, wie ein auf völlige Individualisierung angelegter bürgerlicher Antirassismus meint.
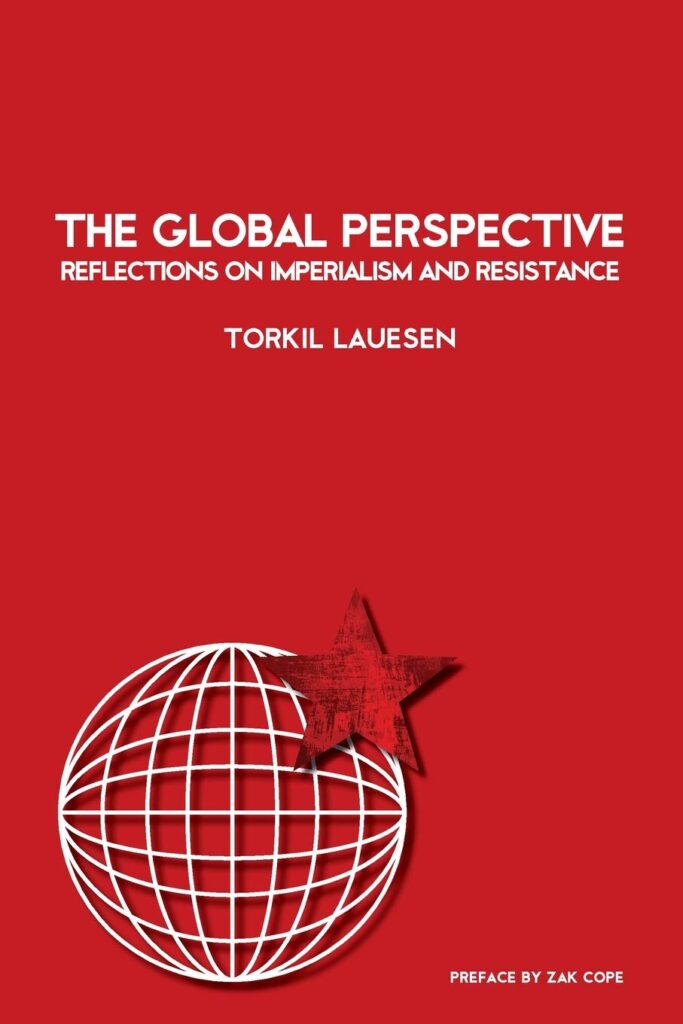
Weiters zeigt sich in den Globalen Warenketten in bestimmten Sektoren – ganz deutlich in der Textilindustrie, aber auch in vielen „Exportproduktionszonen“ generell – ein überwiegender Anteil von Frauen, die noch schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen und einer Reihe zusätzlicher Belastungen – von familiären oder kulturellen Verpflichtungen bis sexualisierter Gewalt – ausgesetzt sind. Die Auslagerung der sozialen Kosten der Reproduktion der Ware Arbeitskraft in weitere Familienzusammenhänge gehört genauso in diesen Bereich wie das internationale „gender pay gap“ und das Problem der Kinderarbeit. Auch hier ist es eine Frage des Klassenstandpunkts: Sind die Textilarbeiter:innen in Bangladesch ein Bezugspunkt feministischer Kämpfe oder die Girlboss-Stars des Westens, die ihre Modekollektionen in Bangladesch nähen lassen?
Die Ausarbeitung einer antiimperalistischen Theorie auf Grundlage des Marxismus ist aber vor allem in einer Hinsicht zentral: Wer sich als Sozialist:innen in der Klassenfrage ausschließlich auf den Bezugsrahmen der „eignen“ Arbeiterklasse innerhalb der nationalen Grenzen stellt, landet in den imperialistischen Metropolen nahezu automatisch bei Opportunismus und Sozialchauvinismus. In den Worten Lenins: „Die ökonomische Grundlage des Opportunismus und des Sozialchauvinismus ist ein und dieselbe: die Interessen einer ganz geringfügigen Schicht von privilegierten Arbeitern und Kleinbürgern, die ihre privilegierte Stellung, ihr ‚Recht‘ auf Brocken vom Tische der Bourgeoisie verteidigen, auf Brocken von den Profiten, die ‚ihre‘ nationale Bourgeoisie durch die Ausplünderung fremder Nationen, durch die Vorteile ihrer Großmachtstellung usw. einstreicht.“Und dieser Standpunkt führt unweigerlich zum Verrat der Interessen des gesamten Proletariats.
| Globale Jagd nach dem Mehrwert: Drei aktuelle Bücher über ImperialismusMaulwuerfe 16. Januar 2022 - 11:54
[…] lowerclassmag.com… vom 9. Januar […]