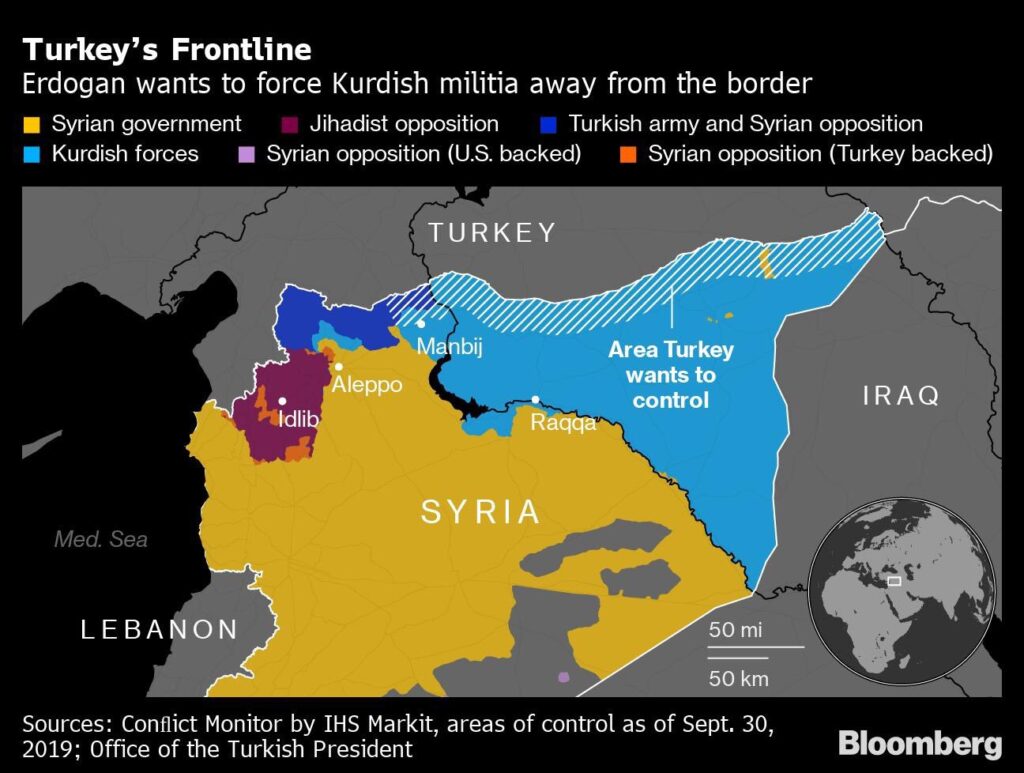Am 20.1 wurde Donald Trump zum zweiten Mal als Präsident der USA vereidigt. Seitdem arbeitet die US-Regierung an der Umsetzung ihrer nationalistischen Pläne. Wir wollen im zweiten Teil von „Der große Diktator (im Werden)“ nachvollziehen wie weit diese Barbarei indes fortgeschritten ist, wer relevante Akteure in der rechten Regierung sind und wie der Sieg der MAGA Ideologie das Verhältnis von Innen und Außen, sowie von oben und unten, in den USA neu bestimmt.
Pierre Roggen
Außen
Die aktuellen Entwicklungen im kapitalistischen Zentrum überschlagen sich mit enormen Folgen für die Marginalisierten außer- wie innerhalb. Durch die Kürzung von US-AID werden Millionen Menschen im globalen Süden fortan keine notwendige medizinische Unterstützung mehr erhalten. Außerdem wollen die USA nach außen härter um sich greifen: Panama Kanal, Gaza, Grönland, Mexiko, Kanada. Alte Gewissheiten des Pax Amerikana und Erinnerungen an das Ende der Geschichte scheinen überholt. Wo das Empire früher, unter Freunden und Abhängigen, noch Spendierhosen im Sinne einer Soft-Power anhatte, wird mittlerweile außenpolitisch fast auschließlich mit (wirtschaftlichen) Drohungen und ideologischer Anbiederung an die (extreme) Rechte gearbeitet. Das Ziel ist die US-amerikanische Hegemonie sowie scheinbar die Hegemonie der jeweiligen indigenen Rechtsradikalen zu stärken. Nach außen markiert die MAGA (Make America Great Again)-Bewegung eine Linie: Wenn ihr über das rechtsradikale bis libertär-konservative Stöckchen springt, bekommt ihr vielleicht einen Knochen. Allein deswegen sollte allen fortschrittlichen Kräften aufgefallen sein, dass die Interessen der aktuellen US-Regierung unseren Interessen diametral gegenüberstehen. Beispiel gefällig?
Ein Kreuzritter als Verteidigungsminister
Der Elitestudent Pete Hegseth diente brav mit Mitte Zwanzig als Infanterist in der Bucht von Guantanamo. Doch damit nicht genug, ging er freiwillig in den Irakkrieg und arbeitete später als Ausbilder für Aufstandsbekämpfung in Afghanistan. So liest sich der Lebenslauf eines Killers. Er trat aus dem Militär mehrmals aus und wieder ein, gründete Veteranengruppen, und ging danach wieder in den aktiven Dienst der Nationalgarde. 2021 wurde er dort mit 11 Anderen aus dem Pool der 20.000 Nationalgardisten aussortiert die Bidens Amtseinführung überwachen sollten. Begründet wurde dies auch aufgrund seiner Tattoos (Jerusalemkreuz/ Deus Vult). Diese und ähnlich Motive werden von christlichen Nationalisten und Neonazis genutzt. Hegseth gibt den antimodernen Kreuzritter im Kampf mit dem Humanismus. So stellte er bei den Anhörungen im Januar klar, dass die Genfer Konvention für seine US-Army nicht gelten würde, die Aufgabe des Militärs sei nun mal das Töten. Außerdem kündigte er an alle „woken“ Offiziere zu entlassen.
Wer ist dieser Typ, der daherkommt wie aus „Handmaids Tale“ gefallen?
Als Journalist und Ehebrecher schaffte er es wortwörtlich in die Fox and Friends Family aufgenommen zu werden. Während seiner Tätigkeit für Trumps Lieblingssender erlangte er unter anderem eine gewisse Berühmtheit dafür, dass er sich für die Begnadigung von verurteilten Kriegsverbrechern wie Eddie Gallagher einsetzte. Der mittlerweile pensionierte Navy-Seal, bekannt dafür mit seinem „Bodycount“ von über 240 Tötungen anzugeben, wurde mehrerer disziplinarischer Vergehen und Menschenrechtsverletzungen beschuldigt. Und ich sag mal so: im amerikanischen Militär muss man sich wirklich anstrengen, damit so was nicht unter den Teppich gekehrt wird. Gallagher soll einen minderjährigen Gefangenen mit einem Messer getötet und Bilder von sich und der Leiche per Messenger verschickt haben. Kollegen behaupteten außerdem, er hätte als Scharfschütze mindestens zwei tödliche Schüsse auf Zivilisten abgegeben. Dass er Kameraden, die ihn meldeten, mit demTod bedrohte, gab wohl den letzten Ausschlag zu seinem Prozess. Verurteilt wurde Gallagher dann aber nur dafür, mit der Leiche des Minderjährigen posiert zu haben. Ein unter Immunität aussagender Sanitäter gab an, den Jungen „aus Mitleid“ selbst getötet zu haben. So nämlich. Das Militär schützt sich eben doch selbst. Dennoch wurde Gallagher degradiert, was Trump jedoch auf Anraten von Hegseth medienwirksam wieder rückgängig machte. Nun ist Hegseth, der blutrünstige Patron der Kriegsverbrecher, also Kriegs- äh Verteidigungsminister und die US-Army vollzieht eine stramme Rechtswende.
Innen
Trump scheint persönliche Rechnungen begleichen zu wollen. Er ließ durch Elon Musks DOGE-Team beim FBI die Verantwortlichen für die Ermittlungen rund um den 6. Januar Aufstand feuern. Angeblich zirkuliert eine Liste mit insgesamt 6000 Agenten, die mit dem Fall befasst gewesen waren. Diese ebenfalls zu feuern käme bei offiziell insgesamt 38.000 Agenten des FBI, einem personellen Kahlschlag, ja fast schon einem Putsch gleich.
Außerdem werden erste unbequeme Richter angegriffen. So wird öffentlich gegen Richter geätzt die gegen manche „executive orders“ Trumps geurteilt hatten. Wie zum Beispiel gegen den Zugriff der Musk-Behörde auf enorme Mengen an Steuer- und Sozialnummern.
Dass Elon Musks Angestellte sehr junge blasse Typen in zu großen Anzüge sind, gibt der Tragödie ein weiteres Mal den Anstrich der Farce. Doch wir sollten nicht irren, das Projekt der Rechten ist als langfristiger Plan konzipiert. Es wird kontinuierlich die eigene Position ausgebaut.
ICE (Immigration and Customs Enforcement) und Army organisieren derweil die im Wahlkampf versprochene Menschenjagd.
Die Regierung geht juristisch gegen demokratische „Sanctuary Cities“ wie Chicago vor, während sie bereits auf medienwirksame Weise Verschleppungen organisiert. Das Militär übernimmt Transport und scheinbar auch Inhaftierungen. So wurde Anfang Februar die Verschleppung erster Undokumentierter auf die US-Militärbasis Guantanamo bestätigt. Noch ist unklar, welches Ausmaß diese Barbarei annehmen wird. Doch es sieht nicht gut aus für 11 bis 14 Millionen Menschen, die ohne die richtigen Papiere in den Vereinigten Staaten leben. Viele davon in Kalifornien, Texas und Illinois (Chicago). Allein am 27.01. wurden 1200 Menschen inhaftiert. Im Vergleich: Biden ließ im Schnitt täglich 311 Menschen abschieben.
„Es gibt niemanden der unsere Grenze besser überwachen und kontrollieren kann“- Trump über Tom Homann (Direktor ICE)
Dieser Homann war bereits einmal nach Trumps erstem Sieg 2016 bis Juni 2017 ICE Direktor und dürfte die Institution gut kennen. Zumal er schon zu Obama in die ICE-Führungsriege aufstieg. Homann forderte kurz vor Jahresende, die Kapazitäten der Behörde immens zu steigern. Anstatt 40.000 sollen in Zukunft 100.000 „Schlafmöglichkeiten“ in Abschiebehaft verfügbar sein. Im Vergleich: Deutschland hatte 2019 knapp 480 Betten und schob mehr als 22.000 Menschen ab. Weltweit sind ICE und Homeland Security sowieso schon die mächtigsten Behörden ihrer Art.
Die Re-Aktivierung des skandalumwobenen Foltergefängnisses Guantanamo für das nationalistische Vertreibungsprojekt verheißt nichts Gutes. Die Kapazitäten Guantanamos sollen auf unglaubliche 30.000 steigen. Zudem hatte Bukele (El Salvador) angekündigt, Papierlose für die USA zu inhaftierten.
Verständlicherweise liegt ein Schleier aus Angst und Verunsicherung über den migrantischen Communities. Jedoch kam es jüngst zu einer ersten Welle politischer Demonstrationen, getragen von Schüler:innen und Studierenden. Die gewaltsame Neuordnung von innen und außen ist im vollen Gang. Doch wie sieht es mit oben und unten aus?
Das (Unten und) Oben von MAGA
11% der amerikanischen Bevölkerung müssen von weniger als 12.800 USD im Jahr leben und zählen als arm. Die Hälfte aller Jobs zahlt nicht mehr als 48.000 USD (Median Einkommen in den USA/ 2023) was je nach Wohnort und Familiengröße nicht unbedingt ein sorgenfreies Leben garantiert. So kann die Jahresmiete für eine Person in den Metropolen wie Los Angeles oder New York schonmal 40.000 USD und mehr kosten. Die Mittel- und Unterschicht der Vereinigten Staaten kämpfen mit Inflation, Gentrifikation, teuren Krankenversicherungen und hohen Medizinpreisen. Bernie Sanders bemerkte nach der Amtseinführung, dass Trump in seiner Einführungsrede keinen einzigen dieser Punkte ansprach. Warum sollte er auch? Trump repräsentiert in erster Linie die Interessen der reichsten Amerikaner.
Musk, Bezos und Zuckerberg besitzen so viel wie die unteren 50% der USA. Und sie standen während der Einführung geschlossen hinter ihm. Musk wollte einfach zeigen, dass er ein Akteur ist und mitgestalten wird. Bezos stand eher kleinlaut hinter Trump. Er spendete brav 1 Million und streamte die Zeremonie auf Amazon Plus. 2016 hatte er Trump noch eine Gefahr für die Demokratie genannt. Letztes Jahr gab seine Zeitung Washington Post („Democracy dies in Darkness“) erstmals keine offizielle Wahlempfehlung für die Demokraten mehr aus. Und erst kürzlich kündigte eine Karikaturistin die ihre Zeichnung (siehe oben) nicht veröffentlichen durfte. Zuckerberg (Meta) und Sundar Pichai (Google) vollzogen ähnliche Demutsgesten. Lagen ihre Konzerne manchmal mit der Regierung Trump1 über Kreuz, so spendeten dieses Mal beide brav Geld und Applaus. Dafür durften sie in einer Reihe mit Tim Cook (Apple) und Sergey Brin (Google) das Spektakel auf besseren Sitzplätzen verfolgen als Mitglieder der Trump-Regierung. Die Senatorin Elisabeth Warren kommentierte die Sitzordnung auf Twitter: „Das sagt alles“.
Teile der herrschenden Klasse versammeln sich hinter Trump – schließlich gilt es, die Situation zu nutzen. Zur „Inauguration“ genannten Einführung kamen jede Menge langjährige Unterstützer. Da wäre der Milliardär Schwarzman, CEO der Vermögensverwalter Blackstone Group, eng verwandt mit Blackrock, dem ehemaligen Arbeitgeber von Friedrich Merz. Forbes Platz 21 mit 43,6 Milliarden USD. Oder: Miriam Adelson. Witwe des verstorbenen Casino-Moguls Sheldon Adelson. Ex-Forbes Platz 28 mit 33,5 Milliarden USD. Dieser war als Lobbyist der israelischen Rechten bekannt. Das Ehepaar unterstützte Trump schon 2016-2020 mit über 420 Millionen USD. Miriam Adelson saß während der Zeremonie in der Nähe von Bernard Arnault (Moet Hennesy Luis Vuitton), Forbes Top 3 aber aktuell hinter Musk. Arnault würde bestimmt ungern hohe Zölle für seine Luxusprodukte nach Amerika zahlen, mal sehen, ob sich da was machen lässt. In gelösterer Stimmung war Harold Hamm, Öl- und Gasmagnat. Er soll im April 2024 ein Treffen organisiert haben, bei dem Öl- und Gasproduzenten insgesamt eine Milliarde an Wahlkampfunterstützung für die Trump-Kampagne sammelten. Obwohl er 2012 noch den gemäßigteren Mitt Romney unterstützte, ist er seit 2016 ein MAGA-Supporter. Auch der mittlerweile 94-jährige Bernard Marcus, Mitgründer der Baumarktkette Homedepot, ca. 11 Milliarden schwer, zählt zu den etablierten Geldgebern Trumps. Seit 2016 gab er mehr als 16 Millionen USD. Bekannt für seine Einflussnahme in akademischen Milieus ist William Ackman, Gründer der Pershing Square Holdings. Er gilt als treibende Kraft hinter der Absetzung von Claudine Gay als Präsidentin der Elite-Uni Harvard. Ferner liefen: Abenteuer-Kapitalist und Repräsentant des rechten Silicon Valley Douglas Leone, Jan Koum, Mitgründer von Whatsapp, Hedgefond-Manager Paul Singer, das Ehepaar Uhilein welches die Logistikfirma Uline besitzt. Und ein Mann mit besonders schlechten Karma: der Pipeline-Betreiber Kelcy Warren. Dessen „Dakota Access Pipeline“ wurde gegen enormen indianischen Widerstand durchgesetzt.
Man könnte fast meinen, gewisse Kapitalfraktionen freuen sich darauf, mit am Tisch zu sitzen, wenn das spät-amerikanische Empire nochmal richtig gemolken wird. Allein die Luftfahrtbranche (Space X, MISC und Bigelow Aerospace), welche stark auf staatliche Aufträge angewiesen ist, übergab Trump direkte und indirekte Spenden von 282 Millionen USD. Andere prominent vertretene Industrien waren Investment, Gesundheit und Altersvorsorge mit zusammen über 620 Millionen USD Wahlkampfspenden. Wer solche Zahlen liest, wird um die Erkenntnis nicht herumkommen, dass in diesen Industrien ein bedeutender Mehrwert erzeugt wird, während der Profit nach oben durchgereicht wird. Die Öl- und Gasindustrie darf, wie die Baubranche, Tabakindustrie, Anwaltsvereine, Auto- sowie Elektrowarenhersteller natürlich nicht fehlen, wenn Natur und öffentliche Gesundheit wieder einmal dem Profit untergeordnet werden. Die größten amerikanischen Banken haben es neulich vorgemacht und sind aus ihrer halbherzigen Selbstverpflichtung zu mehr Nachhaltigkeit und dem Ziel der Klimaneutralität ausgestiegen. Wenn es nach den Interessen dieser Herrschaften geht, soll sich die Rendite aus Investments in Fossile, Immobilien und Tech (wieder) erhöhen. Dafür wird ein faschistisches Rollback toleriert, wenn nicht sogar herbeigesehnt. Diese Mischung aus Rentiers der Eigentums- und Immobilienverwaltung, einer scheinbar immer größer werdenden autoritären Fraktion des Silicon Valley, den Raketen- und Raumfahrtunternehmen sowie den fossilen Logistik, Extraktions- und Industriekapitalisten kann sich sicherlich darauf einigen, das alte Akkumulationsregime weiter als ihr Vehikel zu betrachten. Und es an manchen Stellen sogar auszubauen. Die Folgen für den Klimawandel liegen auf der Hand. Doch an den Internetkapitalisten und Social Media CEOs soll es nicht scheitern. A propos: die Interessen der unteren Klasse spielen bisher absolut keine Rolle in der Neuordnung des Empires.
Denn der „amerikanische Traum“ wird vom Ende her gedacht. Wer aus der hochkarätigen Versammlung der gesellschaftlichen Elite im Weißen Haus verschwendet einen Gedanken an den Tellerwäscher, der bei einem Mindestlohn von 7,25 USD gerne zum Millionär werden würde?
Der Politikbetrieb erscheint erhaben über die materiellen Sorgen der Amerikaner*innen.
So wurde fleißig gesammelt und insgesamt waren es gut 1,28 Milliarden USD Großspenden allein für den Trump Wahlkampf 2024. Mit Kleinspenden und den Ausgaben der übrigen republikanischen Kandidaten hatten die Republikaner ein Budget von knapp 2 Mrd USD. Die Biden/Harris-Kampagne war ungefähr gleich gut ausgestattet. Insgesamt also rund 4 Mrd USD. Die Wahlkampffinanzierung erreicht in den Vereinigten Staaten zuverlässig alle vier Jahre neue Rekordwerte.
Die faschistische Internationale
Es ist nicht verwunderlich, dass der reichste Mensch der Welt in der Politik gut vernetzt ist. Er kann sich schon lange im Namen seines Konzerns mit Staatsoberhäuptern treffen: Scholz und Modi empfingen ihn in allen Ehren. Macron und Meloni trafen ihn letztes Jahr jeweils in einem informelleren Rahmen. Und zumindest Meloni schien Musk dabei sehr sympathisch gewesen zu sein, er bezeichnete sie als „wertvolles Genie“. Erdogan bat ihn, eine Tesla-Fabrik in der Turkei zu etablieren. Er flirtet mit Bukele, Bolsonaro usw. Die Liste ließe sich erweitern. Der springende Punkt ist, dass Musk weltweit faschistische und konservative Akteure um sich schart. Dies könnte eine weltweite Renaissance des Faschismus beschleunigen. Er tritt dabei als eine Art faschistischer Außenminister auf. Siehe Talk mit Weidel plus Auftritt im AfD-Wahlkampf. Oder die Medienkampagne für den inhaftierten Robinson im Vereinten Königreich. Außerdem die aktive Diffamierung mehrerer europäischer Staatsoberhäupter. Was vor ein paar Jahren noch die Arbeit von randständigen Akteuren wie Steve Bannon und dergleichen war, wird heute vom offiziell reichsten Mann der Welt mit zugehörigem Social-Media Imperium aggressiv, ja, geradezu manisch vorangetrieben. So gesehen könnte Musk tatsächlich die Art und Weise verändern, wie im amerikanisch-europäischen Block Politik gemacht wird.
Indirekte Auswirkungen
Nun sind es aber nicht alleine die Handlungen der neuen US-Regierung und ihres international-faschistoiden Machtblocks, welche uns Schritt für Schritt in eine unsichere Zukunft führen. Es geht auch um das Verhalten der Angepassten, der Gleichgültigen, der Falsch- und Uninformierten, derjenigen die still und leise profitieren und jener, die ihre Demut schonmal präventiv demonstrieren. Beispiel? Eine junge Meterologin verlor ihren Job bei einem Nachrichtensender, nachdem sie den faschistischen Gruß Musks in den sozialen Medien kritisiert hatte. Freedom of Speech, aber halt „the oligarch way“. Hier treffen sich Plattformkapitalismus und der moderne Faschismus. Auf der einen Seite haben Musk, Zuckerberg und ein paar andere, die Kommunikation der digitalen Räume als Rhetorik in die Politik gebracht und andererseits eben auch die Politik auf Social Media geholt. Ein entscheidender Vorteil, den die Internetkapitalisten in die faschistische Internationale einbringen. Zur selben Zeit zeigen sich viele der demokratisch-liberalen Politiker, bspw. die Sozialdemokraten Scholz und Starmer (UK), von einer diskursiven Auseinandersetzung überfordert.
Diese Überforderung des politischen Gegners ist integraler Bestandteil der Stratgie der Rechten. Umso mehr braucht es einen klaren, globalorientierten Blick von links. Die (zugegebenermaßen global variierende) Ablehnung der Faschisten und ihrer Scharlatanerie böte die Möglichkeit für fortschrittliche und widerständige Kräfte, zumindest in einem Rahmen die gleiche Sprache zu sprechen.
Fotos: President Trump signs post-inaugural documents (January 20, 2025).jpg by Office of Speaker Mike Johnson, CC0 via wikimedia