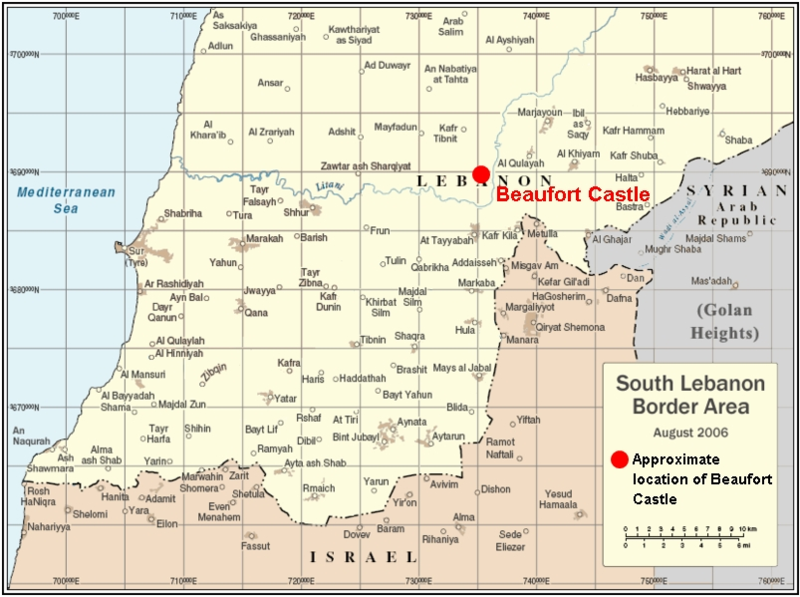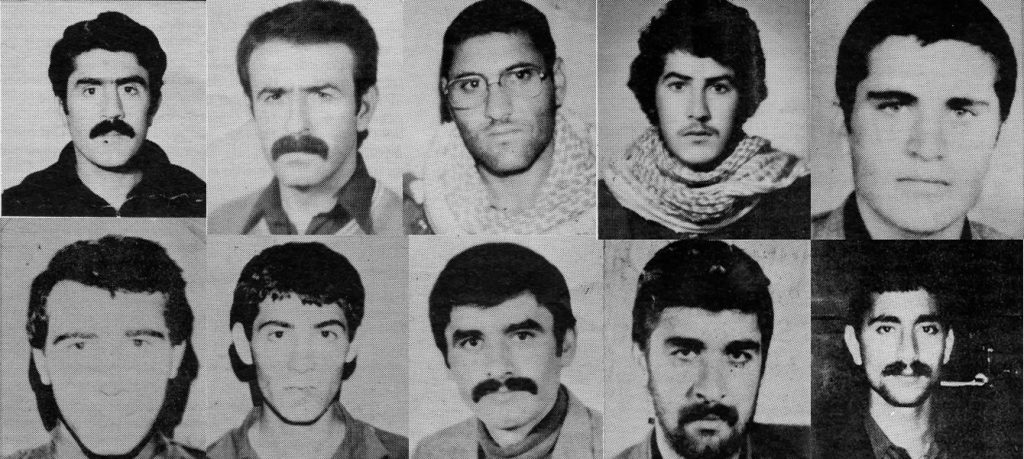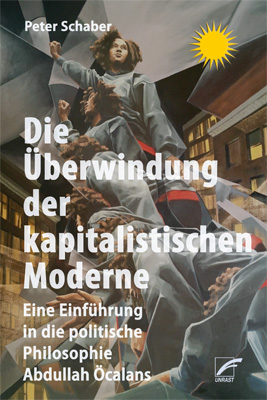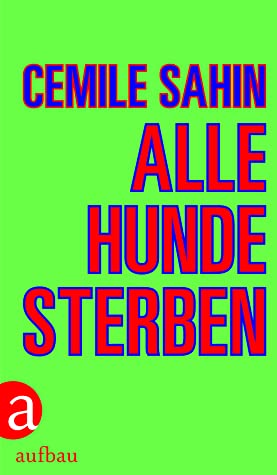Am 16. März jährte sich der Giftgasangriff irakischer Truppen auf die kurdisiche Stadt Halabdscha zum 34. Mal. Unsere Autor:innen Lea Steding und Wanja Musta waren zu den Gedenfeierlichkeiten in Halabdscha und schreiben über die Hintergründe des Massenmordes und die Rolle Deutschlands bei seiner Durchführung.
Es gibt eine Metapher in Kurdistan für das, was am 16. März 1988 in der Stadt Halabdscha passiert ist: „elmar kokosu“, der „Geruch von Äpfeln“. Nach einer Bombardierung, beim Verlassen der Schutzräume stieg den Überlebenden dieses Aroma in die Nase. Ein Zeitzeuge berichtet: „Anfangs roch es wie vergorener Müll, dann entfaltete sich ein Duft wie von süßen Äpfeln“. Innerhalb der nächsten Stunden starben über 5.000 Menschen an den Folgen des Giftgases. 10.000 weitere wurden durch schwerste Verbrennungen und Verätzungen dauerhaft geschädigt.
Der erste Journalist, der Halabdscha nach dem Angriff erreichte, war der türkische Fotograf Ramazan Öztürk. In einem Interview beschrieb er: „Wir kamen 24 Stunden nach dem Angriff in die Stadt. Es war geradezu lautlos. Keine Vögel, keine Tiere. Nichts Lebendiges war zu sehen. Die Straßen waren mit Leichen bedeckt. Ich sah Säuglinge, die in den Armen ihrer toten Mutter lagen. Ich sah Kinder, die im Todeskampf ihren Vater umarmt hatten. Während des Fotografierens habe ich die ganze Zeit geweint und zu Gott gebetet, dass es ein Traum sei und ich gleich aufwache. Ich erinnerte mich an Berichte aus dem jüdischen Holocaust, wie die Opfer in den deutschen Gaskammern übereinander nach oben geklettert wären, um voller Verzweiflung dem Gas zu entkommen. In Halabdscha sah ich viele, die in Gruppen gestorben waren und so wirkten, als hätten sie gemeinsam versucht das Gift nicht einzuatmen.
Ein Blick in die Vergangenheit
Vor dem Giftgasangriff hatte am Morgen die irakische Luftwaffe unter Saddam Hussein die Stadt bombardiert. Halabdscha war unmittelbare Frontlinie und wenige Tage zuvor waren iranische Truppen in der Stadt gewesen. Die Kurd*innen selbst wurden von irakischer Seite als Verbündete von dem Kriegsgegner Iran bezeichnet. „Vernichtet sie“, lautete einer der Befehle des Regimes Saddam Husseins.
Die Zentralregierung Iraks hatte zu diesem Zeitpunkt ein besonderes Augenmerk auf Halabdscha. Die Autonomiebestrebung der Kurd*innen hatten sich bis ins Jahr 1987 zu Anti-Regierungsprotesten zugespitzt. Die Antwort durch das irakische Militär waren Hinrichtungen von Demonstrant*innen, zahlreiche Verhaftungen und das Einreißen der Häuser derer, die den Widerstand gegen die Regierung unterstützten.
Bereits zu der Zeit war bekannt, dass die irakische Luftwaffe Giftgasangriffe gegen dutzende kurdische Dörfer durchführte. Auch die Gesellschaft für bedrohte Völker berichtete in deutschsprachigen Medien darüber.
Ein Tag vor dem großen Giftgasangriff gegen Halabdscha war die Stadt von kurdischen Rebell*innen der PUK (Patriotic Union of Kurdistan) mit Hilfe der Iranischen Armee eingenommen worden. Die PUK ist auch heute noch hier die dominante politische Partei.Als Antwort darauf flogen ab 11 Uhr morgens Kampfflugzeuge der irakischen Luftwaffe über die Stadt und die Bombardierungen begannen.
Die deutsche Verstrickung
Auch deutsche Akteur*innen waren an diesem unfassbaren Verbrechen beteiligt. Doch auch diese Verwicklungen geraten zu leicht in Vergessenheit. Unkrautvernichtungsmittel sollen es gewesen sein, deren Zutaten deutsche Firmen in Unmengen an den Irak verkauften. Über zwei Drittel der irakischen Giftgasanlagen kamen, laut Berichten von Medico international, von deutschen Firmen. „Später wurde bekannt, dass in den Firmen zahlreiche Mitarbeiter des BND arbeiteten. Deutsche arbeiten an der Weiterentwicklung der SCUD-Raketen und am irakischen Atomprogramm.“, heißt es weiter in dem 2013 veröffentlichten Bericht „Halabdscha – In Erinnerung an den Giftgasangriff auf irakische KurdInnen“.
Der Menschenrechtsanwalt Gavriel Mairone vertritt die Überlebenden in einem Prozess gegen die Täter. Aufgrund der ihm vorliegenden Beweismittel hält er drei Firmen aus Deutschland für die wichtigsten Akteure im Bau der Giftgasalagen unter Saddam Hussein: Das ist zum einen die Preussag AG, die ihren Namen 2002 in TUI umgeändert hat und heute ihre Geschäfte als Tourismusunternehmen macht; zum zweiten die Firma Karl Kolb und das Subunternehmen Pilot Plant – sie haben die Chemiewaffenfabriken entworfen und geliefert. Mit dabei war auch die Konstruktionsfirma Heberger Bau, welche Bunker und Untergrund-Fabriken errichtet hat.
So lieferten diese Firmen doch nicht nur Unkrautvernichtungsmittel, sondern gleich die ganze Infrastruktur zur Massenvernichtung dazu. Auch Kühlhäuser und Gaskammern, um das Gift zu testen, gehörten dazu. Der US-amerikanische Anwalt Gavriel Mairone gibt an: „Zwei riesige Inhalationskabinen haben Karl Kolb und TUI bei der deutschen Firma Rhema Labortechnik bestellt. Diese waren drei mal drei Meter groß, was viel zu groß ist, um Tests an kleinen Insekten durchzuführen. Die waren entworfen worden, um zunächst Tests an Hunden durchzuführen und später an Eseln. Es gibt Berichte, dass auch iranische Kriegsgefangene benutzt wurden, um die Chemiewaffen an ihnen zu testen.“
Das alles ist den deutschen Behörden schon weit vor dem Anschlag bekannt gewesen. So berichtete der US-Geheimdienst bereits in den frühen 80er-Jahren dem Kölner Zollkriminalinstitut, mit hunderten Dokumenten, über die Unterstützung der Firmen des Saddam-Regimes. Trotz dieser Informationen und den gesammelten Beweisen blieb eine tiefgehende rechtliche Aufarbeitung von deutscher Seite aus.
In einer späteren Anfrage des SWR2 wiesen die Firmen die Vorwürfe zurück. Die TUI AG berief sich darauf, dass ihr Firmenname und der Zweck sich seit 2002 geändert habe und sie sich komplett aus der industriellen Sparte zurückgezogen habe. Dadurch kann, laut Gericht in Darmstadt, kein Zusammenhang mehr zu den Ereignissen im Irak 1988 hergestellt werden. Karl Kolb versucht, den Transport der Materialien nicht zu leugnen, sondern nur das Wissen um dessen Nutzung. Doch war die deutsche Botschaft in Bagdad wohl schon Anfang der 80er-Jahre von einem Mitarbeiter der Firmen darauf Aufmerksam gemacht worden, dass es sich bei den Geschäften nicht um Ungezieferbekämpfung handelt. Dieser Mitarbeiter wurde einen Monat später gekündigt. Als der deutsche Ingenieur Fritz-Willi Dörflein ein Jahr später die Anlage besuchte und einen der Arbeiter fragte, was sie dort machten, soll ihm dieser geantwortet haben: „Wir stellen Mittel gegen Ungeziefer her – gegen Wanzen, Flöhe, Heuschrecken, Perser, Israelis“.
Auch auf politischer Ebene ging die Übernahme von Verantwortung nicht weiter, ganz im Gegenteil. Die Frage ist, inwieweit die deutsche Regierung Reparationszahlungen an die Hinterbliebenen und die Stadt Halabdscha zahlen muss. Im Jahr 2021 lehnte hierzu der Menschenrechtsausschuss den dazu vorliegenden Antrag ab. Dabei stimmten vor allem CDU/CSU, SPD, FDP und AfD dagegen. Die Grünen enthielten sich. Von Seiten der Grünen-Fraktion bezog Kai Gehring Stellung. „Auch wenn wir grundsätzlich das Anliegen teilen, kritisieren wir die Art der Befassung mit derart schweren Verbrechen und die unzureichende Einordnung der ‚Anfal Operation‘ in den historischen Gesamtkontext“, heißt es in seiner schriftlichen Aussage dem SWR2 Wissen gegenüber.
Die Zurückhaltung der deutschen Regierung mit der Aufarbeitung des Giftgasangriffs auf Halabdscha muss auch im größeren Zusammenhang gesehen werden. Berlin zeigt hier nämlich vor allem seine Haltung gegenüber den Kurd*innen. Diese Haltung hat eine Kontinuität. So wurde nach dem Überfall auf Afrin 2018 durch das türkische AKP/MHP-Regime bekannt, dass hier auch deutsche Waffen eingesetzt wurden. Doch statt Waffenexporte zu stoppen, bzw. klare Sanktionen auszusprechen, wurde dem treuen Kunden der deutschen Waffenindustrie die Fortsetzung seines Angriffskriegs gewährt.
Die türkische Regierung bombardiert in Permanenz vermeintliche Stellungen „terroristischer“ Gruppen in kurdischen Gebieten. Gemeint ist damit die Guerilla der PKK. Eine historische Parallele zu Halabdscha ist dabei auch nicht weit entfernt. Erdogan behauptet, er würde „nur“ die PKK bombardieren, genauso wie Saddam Hussein behauptete, er würde „nur“ die iranische Armee bombardieren, aber tatsächlich werden Zivilist*innen und Geflüchteten Lager die Opfer dieser Angriffe. Doch die deutsche Regierung sieht keinen Grund einzugreifen. Dabei spielt die sogenannte deutsch-türkische Freundschaft eine große Rolle. Diese bekommt die Bevölkerung vor allem dadurch mit, dass deutsche Parlamentarier*innen an ihrer Ausreise in kurdische Gebiete gehindert werden, wie im Juni 2021 als Hamburgs Linken-Fraktionschefin Cansu Özdemir zu einer Friedensdelegation in die Autonome Region Kurdistan reisen wollte; oder dadurch, dass selbst Kurd*innen in Deutschland ständiger Gefahr einer Abschiebung durch die Bundesregierung in die Türkei ausgesetzt sind. Was sie dort erwartet ist eine Verurteilung wegen „Terrorpropaganda“ – gemeint sind damit kritische Social-Media-Beiträge für Grundrechte von Kurd*innen, wie es beispielsweise im Fall von Heybet Sener in München aktuell passiert.
Klar ist, dass Saddam Hussein bis zum 2. Golfkrieg durch unklar formulierte Außenwirtschaftsgesetze und durch verdrehte Freiheitsprinzipien seitens Deutschlands unterstützt wurde. So wurden durch die sogenannte Dual-use-Regel, also wenn Geräte sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, die Firmen durch die deutsche Gesetzgebung freigesprochen. Aber auch die deutsche Politik selbst versucht, sich der Verantwortung – damals wie heute – zu entziehen. Wie einst der Sprecher der Kolb-Pilot-Plant sagte: „Für die Leute in Deutschland ist Giftgas eine ganz furchtbare Sache, Kunden im Ausland stört das nicht“.
Damals wie Heute
Heute, 34 Jahre später, sind die Spuren des Anschlags verdeckt. Die Häuser wurden platt gemacht, Keller versiegelt und neue Gebäude darauf errichtet. Nur wenige Ruinen, die Gedenkstätte und ein Park erinnern an das Verbrechen. Doch das Trauma steckt tief in der Gesellschaft und die Gespräche mit den Bewohner*innen führen immer wieder zu dem Ereignis am 16.März.
Auch die Gedenkstätte und die alljährliche Gedenkveranstaltung wird nicht gut von der Bevölkerung angenommen. Ganz im Gegenteil. Während bei der diesjährigen Gedenkveranstaltung an der offiziellen Gedenkstätte sich für kaum mehr als eine halben Stunde Politiker*innen ablichten lassen, formiert sich am Basar eine spontane Gegendemonstration. Die Menschen sind voller Zorn. Ohne Transparente, Fahnen oder Schilder versammeln sie sich und schreien. Wen sie anschreien scheint dabei fast egal. Ob es nun das Militär ist, das die umliegenden Straßen absperrt, oder die Journalist*innen die heran geeilt kommen oder vorbei gehende Passant*innen. Ihnen wird so oder so das Gefühl gegeben, nicht gehört zu werden. Dabei sind die Inhalte ganz klar. Jeder Mensch, der hier wohnt, hat nahe Verwandte durch den Anschlag verloren und dazu oftmals die komplette eigene Existenz. Während schöne Worte jedes Jahr wiederholt werden, übernimmt niemand wirklich Verantwortung. Weder hier im Inland, noch im Ausland.
Dass das den Menschen nicht reicht macht auch Kak Narshirwan klar. Er ist Lehrer an einer staatlichen Schule in Halabdscha. Mit ausländischen Medien spricht er eigentlich nicht, außer er hat das Gefühl, dass sie nicht nur kurz einmal im Jahr über das Leid der Menschen aus seiner Stadt berichten wollen. Er möchte, dass die Perspektive der Leute nach außen kommen. Kak Narshirwan spricht von Verantwortungslosigkeit der Regierung, als er die wenigen verbliebenen zerbombten Teile des alten Basars anschaute. Eigentlich müssten diese in den letzten Jahrzehnten schon längst wieder aufgebaut worden sein, meinte er, aber weder dieser Teil noch die anderen Häuser, die zum Großteil durch die Bevölkerung selbst wieder aufgebaut worden sind, wurde durch die Regierung unterstützt. Der Konflikt zwischen der kurdischen Regierung und den Regierungen der Zentralstaaten, die Kurdistan besetzt halten, im speziellen der irakischen, seinen dabei in den letzten Jahren ein zentraler Punkt gewesen. Die kurdische Regionalregierung in der Autonomen Region Südkurdistan kann sich dabei nicht auf Zuständigkeiten mit dem Irak einigen. Dabei leiden nicht nur die Reparationszahlungen und der Umgang mit Halabdscha darunter, sondern auch alle staatlich organisierten Stellen. So sagt der Lehrer fast beiläufig, dass er seit fast zwei Monaten kein Gehalt bekommt und deswegen seit gut 2 Wochen mit seinen Kolleg*innen fast überall in der Autonomen Region in Streik getreten ist. Auch hier sind sich die zwei Regierungen nicht einig. Es herrscht Perspektivlosigkeit und Frust, erklärt er. Nicht nur Deutschland gegenüber, oder der irakischen Zentralregierung, sondern auch gegenüber den zwei größten Parteien der kurdischen Regierung, die sich immer wieder dem Westen und kapitalistischen Denkweisen anbiedern.
„Die Menschen in Halabja haben vor allem einen Wunsch. Sie wollen gesehen werden. Sie wollen, dass ihr ‚Schicksal‘ als solches anerkannt wird – und nicht als x-beliebiges Kriegsverbrechen in der Menschheitsgeschichte“, wie der Überlebende Omid Hama Ali Rashid sagt. Der „Geruch von Äpfeln“ erinnert noch heute viele Menschen aus der Region an dieses grauenhafte Verbrechen. Doch liegen die Missstände nicht ausschließlich in der Vergangenheit. Sowohl die Suche nach Verantwortlichen und Wiedergutmachung, als auch die Fortführung der Unterdrückung der Kurd*innen zieht sich bis heute fort. Deutschland hat dabei eine wichtige Rolle. Aktuell sieht diese Rolle so aus, dass wechselnde Regierungen die Unterdrückung unterstützen und die Aufarbeitung behindern. So liegt es gerade an der kurdischen Community und deren Unterstützer*innen in Deutschland weiter darum zu streiten, dass die deutsche Bundesregierung ihre Verantwortung anerkennt und ihre „Freundschaft“ mit dem türkischen AKP/MHP-Regime beendet.