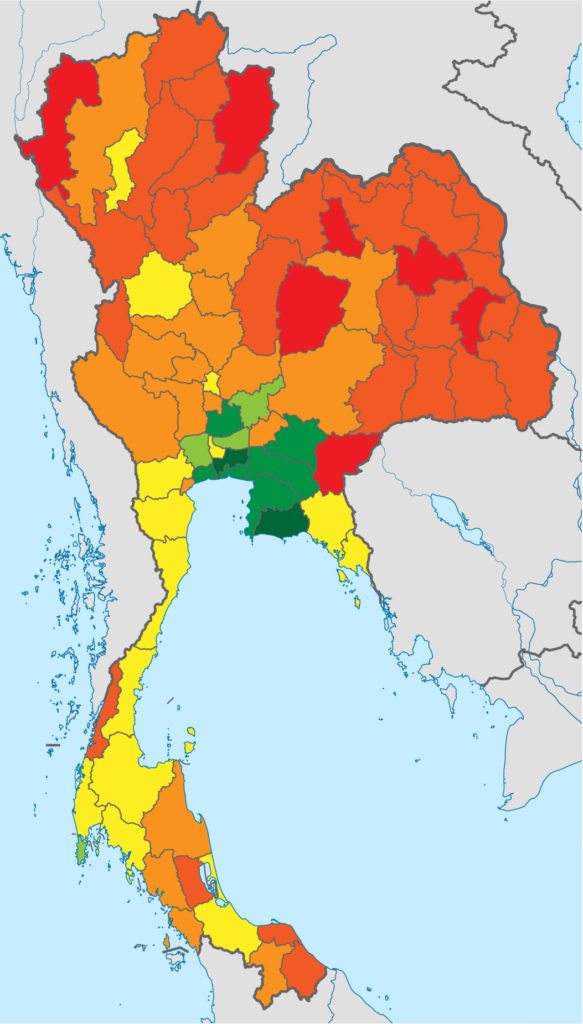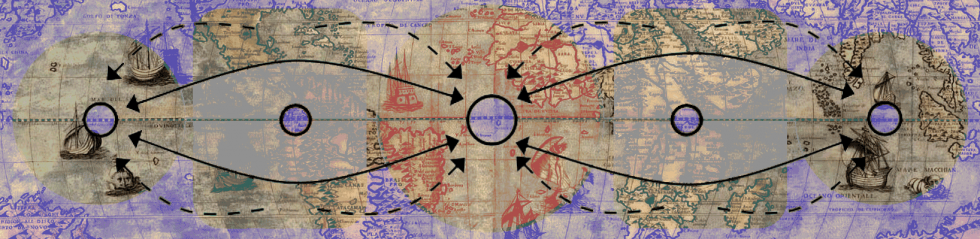„Die Menschen haben gesehen, dass es kein Ende der Geschichte gibt“ – Interview zu den aktuellen Protesten in Serbien
Auf der „People’s Platform Europe“ in Wien kamen im Februar zahlreiche internationalistische Kräfte verschiedener kämpfender Bewegungen Europas unter dem Motto „Reclaim the Initiative“ zusammen, um voneinander zu lernen und gemeinsam nächste Schritte der Organisierung zu gehen. Dort hatten wir die Chance mit zwei serbischen Revolutionären, Marko und Ratibor, zu sprechen. Marko Crnobrnja ist ein internationaler Funktionär der kommunistischen „Partija Radicale Levice“ (dt.: Partei der radikalen Linken), die vor vier Jahren gegründet wurde und die einzige registrierte antikapitalistische Partei in Serbien ist. Schwerpunktmäßig widmet sie sich dem Kampf für eine bessere Wohnsituation in Serbien, gegen Privatisierung und gegen die NATO- und Euro-Integration Serbiens. Ratibor ist Mitglied des „Komitees gegen Krieg und Imperialismus“ in Serbien und versteht sich als Anarchist. Das Komitee funktioniert als Sprachrohr der sich aufbauenden Antikriegsbewegung in Serbien und versammelt organisierte Kommunist:innen, Anarchist:innen und auch weite Teile der Bevölkerung, die sich der Bedeutung des Krieges bewusst sind, ohne sich als links zu verstehen.

In den letzten Wochen gab es große Proteste in Serbien. Könnt ihr uns über die Hintergründe und die aktuelle politische Situation berichten?
Marko: Die Situation wurde durch einen Unfall ausgelöst, bei dem ein Bahnhofsvordach in Novi Sad eingestürzt war und 15 Menschen ums Leben gekommen sind. Es gab darauf direkte Reaktionen: es kam zu einer Reihe von Straßenprotesten, die sich radikalisierten, Studierende haben Fakultätsgebäude besetzt und es baute sich eine starke Studierendenbewegung auf. Diese baute studentische Ausschüsse auf, die nun direkte Demokratie umsetzen, mit einer Plenarstruktur, die unabhängig von allen anderen politischen Oppositions- und liberalen Parteien ist. Wir als Partei der radikalen Linken unterstützen die Studierendenbewegung voll und ganz und respektieren ihre Unabhängigkeit. Denn es gibt viele Fälle, in denen verschiedene Parteien, Einzelpersonen oder andere Organisationen versucht haben, die Studierendenbewegung auszunutzen und politisches Kapital aus ihr zu schlagen. Bei den Protesten selbst geht es nicht nur um die Studierenden. Sie erstrecken sich auch auf andere Bereiche der Gesellschaft und drücken sich in unterschiedlichen Protestformen aus: Boykott, verschiedene Formen des zivilen Ungehorsams und auch unterschiedliche Gewerkschaften haben die Student:innen mit ihren Forderungen unterstützt. Man kann also sagen, dass es sich um einen breiten Aufstand der Menschen in Serbien handelt.
Welche Ergebnisse konnten diese Aufstände bisher erzielen?
Marko: Die Regierung hat zum Beispiel als Reaktion auf die Proteste kostenlose öffentliche Verkehrsmittel eingeführt, um die Wut zu unterdrücken, und hat angefangen, ihre eigenen Funktionäre zu verhaften, und so weiter…
Ratibor: Die Regierung ist gestürzt.
Marko: Ja. Der Premierminister ist zurückgetreten. Es ist noch ungewiss, in welche Richtung die Proteste gehen werden. Das hängt von den Menschen selbst ab. Aber dies ist bei weitem der heftigste Protest, den Serbien in den letzten 20 Jahren erlebt hat, wenn nicht sogar länger.
Ratibor: Die Proteste dauern ja nun schon drei Monate an. Das ist wirklich ein langer Zeitraum. Seitdem sind alle Fakultäten in Serbien blockiert. Die Haupteisenbahnlinien und andere Bahnhöfe oder Kreuzungen werden gelegentlich von Student:innen blockiert. Als Anarchist ist mir dabei besonders wichtig, dass die ganze Bewegung auf direktdemokratischen Versammlungen basiert. Es gibt keine Anführer, niemanden, den die Regierung ins Visier nehmen kann oder ähnliches. Alle Entscheidungen werden von den direktdemokratischen Versammlungen getroffen.
Sind diese außerparlamentarischen Proteste als eine Reaktion auf die parlamentarische Politik Serbiens zu verstehen?
Ratibor: Ja, ich denke, es ist wichtig zu verstehen, warum diese direktdemokratischen Proteste geschehen. Serbien ist ein Land an der Peripherie oder Halbperipherie von Europa, der Welt und den kapitalistischen Zentren. Aber in der Praxis ist Serbien eine Kolonie der EU. Deutschland, Frankreich und so weiter sind die größten Investoren. Die Unternehmen werden hauptsächlich von den europäischen Ländern kontrolliert und auch das parlamentarische System ist typisch für die peripheren Staaten. Der Mann, der jetzt seit 12 Jahren an der Macht ist, Aleksandar Vučić , ist der Fähigste aller bürgerlichen Politiker in Serbien. Er beherrscht das parlamentarische System vollständig, nicht durch irgendwelche diktatorischen Methoden. Die Opposition, die selber auch liberal, bürgerlich und so weiter ist, hat keine Möglichkeiten, die Situation in der Gesellschaft zu beeinflussen. Es gab also eine riesige Aufruhr in der Gesellschaft, als der Unfall passierte. Und die einzige Möglichkeit für die Gesellschaft, darauf zu reagieren, war nicht das parlamentarische System, das zu 100% von diesen Leuten kontrolliert wird, sondern der außerparlamentarische Weg. Und so ist die Bewegung entstanden.
Was ist eure Prognose für weitere Entwicklungen und Erfolge? Was wird geschehen?
Marko: Ich glaube nicht, dass das zu diesem Zeitpunkt irgendjemand wissen kann, nicht einmal der Präsident, nicht einmal die Botschaften! Denn dies ist ein sehr unkontrollierter Moment. Auch wenn es der Präsident zeitweise als eine Farbrevolution darstellte. In den 90er Jahren hatten wir bereits eine Zuspitzung der Bewegung und am Ende, nach dem Sturz des Milošević-Regimes, kam eine Welle der Privatisierung und Liberalisierung aller sozialen Dienste in Serbien. Deshalb haben viele Menschen Widerstand gegen die Idee der Farbrevolution und das Regime von der Straße aus zu ändern.
Diese aktuelle Bewegung wird jedoch nicht von externen Akteuren gesteuert. Klar ist, dass es sich hier um direktdemokratische Versammlungen handelt, die noch nicht einmal ideologisch ausgerichtet sind. Es ist weder ein linker noch ein rechter Protest. Es gibt alle möglichen Botschaften und es ist ungewiss, in welche Richtung es gehen wird. Die Opposition drängt auf eine Art Übergangsregierung, in der die EU eine Art Kompromissregierung zwischen der Opposition und der Regierung vermitteln würde. Die Opposition hat nicht die politische Legitimität, eine solche Regierung zu bilden. Denn so ist es auch bei den Protesten in den 90er Jahren nach Milošević gewesen. Und die Menschen sind nicht bereit, den gleichen Weg noch einmal zu gehen. Auch Teile der Student:innen haben die Idee einer Übergangsregierung zwischen Regierung und Opposition abgelehnt. Es gibt also keinen Plan.

Was sind denn die unmittelbaren Forderungen der Bewegung?
Marko: Die Proteste fordern eindeutig vier Dinge. Die erste ist die Veröffentlichung aller Unterlagen über den Einsturz des Bahnhofdachs selbst, über den Bau und so weiter. Zweitens: die Verhaftung und strafrechtliche Verfolgung aller Personen, die die protestierenden Student:innen zu Beginn der Proteste und später angegriffen haben. Drittens: die Freilassung der verhafteten Student:innen, die von der Polizei wegen ihrer Proteste festgenommen wurden. Und viertens: die Erhöhung des Bildungsbudgets und die Senkung der Bildungskosten. Diese vierte Forderung wurde bereits erfüllt. Und die Regierung stellt sich selbst so dar, als ob sie alle Forderungen erfüllt hätte. Aber das ist nicht ganz richtig. Nicht alle Dokumente wurden freigegeben. Nicht alle Leute, die die Student:innen angriffen haben, wurden verhaftet… Wir werden sehen, wie die Umsetzung läuft. Die Proteste werden weitergehen, bis diese Forderungen erfüllt sind. Es ist also Aufgabe der Regierung und anderer Politiker:innen, der Oppositionspolitiker:innen, eine Lösung für diese Krise zu finden.
Ratibor: Mir ist wichtig zu sagen, dass diese Bewegung aus meiner Sicht bereits Großes geleistet hat. Ich meine, wir leben im Moment in einer Situation, in der der Staatspräsident öffentlich im Fernsehen die Idee debattiert, dass die direktdemokratischen Versammlungen den ganzen Staat kontrollieren sollten. Ich denke, dass dies eine wichtige Sache für das öffentliche Bewusstsein und die Bewusstseinsbildung ist: Es geht darum, eine wirklich selbstverwaltete Gesellschaft zu schaffen. Aber wie Marko sagt, wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Wir versuchen es und drängen darauf, dass sich diese direktdemokratischen Versammlungen überall verbreiten und auch in die Fabriken gehen. Gestern wurde beispielsweise eine der Fabriken besetzt und die haben Pläne gemacht. Aus meiner Sicht ist das die Selbstverwaltung, die nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens abgeschafft wurde und die nun zurückkehrt.
Wie positionieren sich andere Staaten in dieser Situation gegenüber der serbischen Regierung? Wie beeinflusst das die Lage?
Ratibor: Die Mehrheit der Staaten und imperialistischen Kräfte in der Welt unterstützen die serbische Regierung – sei es EU, die erklärt hat, dass sie keinen außerparlamentarischen Regierungswechsel unterstützen wird, Russland, die Vereinigten Staaten oder China. Dadurch bewegen sich die Leute auf natürliche Weise auf eine antiimperialistische Position zu. Ein Arbeiter in Novi Sad, der Zeuge des Zusammenbruchs wurde, fing an, öffentlich über die Situation vor dem Unglück zu berichten und die Korruption aufzuzeigen. In einer großen Erklärung sagte er heute, dass dieser Moment eine Gesellschaft schaffen wird, in der alles in den Versammlungen entschieden wird, dass dies die EU-Diktatur zerstören und dass ganz Europa eine anarchokommunistische Gesellschaft sein wird.
Und das ist nur ein ganz normaler Typ, der keine bestimmte Ideologie oder so etwas hat. Er ist einfach ein Typ, der gesehen hat, was passiert ist. Und dann hörte er, wie die Regierung sagte, das seien alles Anarchisten, die das organisieren. Und er sagte am Ende: „Okay, fickt euch… wenn ihr uns jetzt so weit treiben wollt, dann werden wir eine anarchokommunistische Gesellschaft in ganz Europa haben“. Ich denke, das sind wirklich gute Entwicklungen. Dieser Mann hat nicht als politischer Mensch angefangen. Dann begann er infolge der Ereignisse über die letzten drei Monate Dinge zu sagen, wie, dass das Kapital die gesamte EU und Europa kontrolliert. Er ist zu einem Held in den Medien und in den Augen der Mehrheit der Menschen geworden.
Wir sprachen eben schon über die liberale Vereinnahmung revolutionärer Bewegungen nach dem Fall des Milošević-Regimes und die Welle der Privatisierung, die folgte.
Wie können die aktuellen Entwicklungen der Bewegung und der Aufstände vor Vereinnahmung geschützt werden? Und was ist anders heute?
Marko: Also der Mangel an Organisation ist derzeit eines der Probleme. Wir haben zum Beispiel keine wirklich starke Gewerkschaftsbewegung in Serbien. Die Gewerkschaften selbst sind ziemlich korrupt und werden von der Regierung auf indirekte Weise kontrolliert. Natürlich nehmen einzelne Gewerkschaften eine gute Haltung ein und kämpfen für die Menschen, die sie vertreten, aber die Gewerkschaftsverbände als solche sind in Serbien meist problematischer. Es gibt derzeit keine Bewegung der organisierten Arbeiter:innenschaft, die mehr soziale Forderungen durchsetzen könnte. Auch die parlamentarische Politik selbst ist ziemlich eingeschränkt, da eine Kandidatur für eine Wahl in Serbien ziemlich teuer ist. Wir haben Gesetze, die es einer neuen Partei sehr schwer machen, aufzutreten. Man braucht zum Beispiel etwa 50.000 Euro, um eine Partei zu registrieren, und um bei einer Wahl anzutreten, sind es wahrscheinlich etwa 10.000 Euro.
Serbien ist ein relativ armes Land, sodass es für normale, unabhängige Menschen sehr schwer ist, in die parlamentarische Arena zu gelangen. Die Parteien, die es gibt, sind also nicht sehr repräsentativ für das Volk selbst. Sowohl die Regierung als auch die meisten Oppositionsparteien sind pro-EU. Sie wollen den EU-Beitrittsprozess fortsetzen, der in Serbien nicht mehr mehrheitsfähig ist. In diesem Sinne gibt es also keine institutionelle Stimme der Arbeiter:innenklasse, die sich in irgendeiner Weise einmischen und in den parlamentarischen Dialog einbringen könnte. Das ist also der Kern dieser Krise: dass es keine wirklichen Repräsentant:innen gibt. Zwar haben wir in Serbien eine Tradition der Selbstverwaltung durch den Sozialismus, aber diese Geschichte wurde verschüttet und die Menschen wissen nicht gut, wie sie sich organisieren können. Das ist etwas, das überwunden werden muss, wenn wir in Serbien wirklich dauerhafte Veränderungen erreichen wollen.
Ratibor: Genau. Die linke Bewegung ist noch klein, denn sie ist erst in den letzten 20 oder 30 Jahren seit der Miloševic-Zeit entstanden. Im sozialistischen Jugoslawien gab es die Möglichkeit ncht, eine unabhängige linke Bewegung aufzubauen – wenn man ein bisschen linker war, wenn man Stalinist oder so etwas war, dann kam man ins Gefängnis. Erkundigt man sich nach den Positionen der Bevölkerung, merkt man, dass die Leute sehr links sind, aber es niemanden gibt, der das in einem politischen Sinne artikuliert. Die Student:innen der Bewegung sind sehr jung, viele sind um die 2000er rum geboren… Sie erinnern sich nicht einmal mehr an die Selbstverwaltung, sondern nur noch ihre Eltern. Meine Befürchtung ist, dass die bürgerlichen politischen Parteien irgendwie in der Lage sein werden, die Bewegung zu übernehmen. Aber bisher zeigt sich, dass eine große Anzahl der Fakultäten beschlossen hat, das nicht zuzulassen und auf Kontaktversuche der Regierung nicht einzugehen.
In Deutschland gibt es seit dem Zusammenbruch des Realsozialismus und seit der sogenannten Wiedervereinigung das Narrativ vom „Ende der Geschichte“. Es propagiert in den Köpfen der Gesellschaft, dass es keine Alternative zum Kapitalismus und der bürgerlichen Demokratie gibt. Wie erlebt ihr dieses Narrativ, und wie geht ihr damit um?
Ratibor: Nun, ich war mir sicher, dass nach dem 11. September die Fukuyama-Idee vom Ende der Geschichte nicht wirklich präsent sein wird. Ich denke, dass es in Deutschland oder Westeuropa vielleicht eine Frage der aktuellen Stabilität des Systems ist, sodass die Leute nicht sehen, dass der Kapitalismus keine Stabilität bringt. Aber wir hatten das Glück, dass unser System instabil war seit ich geboren wurde. Ich meine, wir hatten Kriege, Zusammenbrüche der Gesellschaften, Veränderungen der verschiedenen Systeme, Farbrevolutionen, wir hatten also all diese Dinge und die Menschen sind offen für etwas anderes. Und in diesem Sinne denkt niemand, dass die Geschichte in Serbien zu Ende ist.
Marko: Im Grunde genommen haben wir in Serbien dieses Ende der Geschichte nun schon seit 25 Jahren erlebt, und die Menschen haben gesehen, dass es kein Ende der Geschichte gibt. Es wird versucht, dieses Ziel zu erreichen, versucht, wie Deutschland zu werden. Das wurde uns in den 90er Jahren gesagt… „wir müssen vorher nur noch ein paar Reformen durchführen, ein paar mehr Unternehmen privatisieren„. Uns wurde gesagt: „dann werdet ihr ein reiches kapitalistisches Land, wie Deutschland, wie Frankreich,“ was auch immer.
Und 25 Jahre später drängen die Politiker:innen immer noch auf die Linie, dass wir die Reformen fortsetzen müssen, dass der europäische Weg der einzige Weg ist, und so weiter. Die Menschen erkennen jetzt, dass diese Art von Fortschritt einfach nirgendwo hinführt, dass wir wahrscheinlich nie der EU selbst beitreten werden. Wir sehen auch an den anderen Ländern, wie Rumänien, Ungarn, die der EU beigetreten sind, dass sich die Probleme, die diese postsozialistischen Länder haben, dadurch nicht grundlegend ändern – denn wie Ratibor sagte, befinden wir uns an der Peripherie des Kapitalismus.
Was bedeutet das?
Marko: Unsere Rolle im Produktionssystem ist eine unterwürfige. Wir bekommen nicht wirklich gute Jobs. Die Leute, die gute Jobs wollen, gehen nach Deutschland oder in die USA und so weiter. Es kommen also nur die schlechtesten Jobs nach Serbien. Es wurde also klar, dass wir aus dieser ewigen Schleife des Endes der Geschichte herauskommen müssen. Und wir sehen auch, dass alles um uns herum in der Welt zusammenbricht. Offensichtlich steht die Geschichte also wieder vor der Tür und wir müssen irgendwie damit umgehen, um zu versuchen, weniger zu sterben als bisher in der Geschichte, denn wir wurden gefoltert mit all den Kriegen. Wir müssen also jetzt handeln, um uns vor dem, was kommt, zu schützen!
Bei der Podiumsdiskussion gerade haben wir einmal mehr gesehen, wie weit die Positionen zur NATO auch innerhalb der Linken seit dem Krieg in der Ukraine auseinander stehen. Wie ist die Stimmung in Serbien in dieser Hinsicht im Moment?
Ratibor: Nun, wir haben das Glück, dass wir 1999 von der NATO bombardiert wurden, sodass die Menschen keine Illusionen über die NATO haben. Und das ist eine gute Sache. Ich denke, Serbien wird natürlich niemals der EU beitreten, aber es wird niemals, ganz sicher niemals der NATO beitreten. Das ist, wie gesagt, ein Produkt der Bombardierung und das lässt sich nicht so einfach auslöschen. Aber was wir jetzt mit dieser Regierung erleben, ist, dass die Regierung nur für die Ausländer arbeitet, weil sie eine bürgerliche Kompradoren-Bourgeoisie ist, keine nationale Bourgeoisie. Sie haben keine eigenen Interessen. Sie arbeiten nur im Interesse eines anderen und stehlen etwas von dem Geld für sich selbst. Das ist sozusagen das Programm, das sie machen.
Was ich damit sagen wollte, ist, dass die serbische Regierung, weil es sich um eine bürgerliche Regierung handelt, weiß, dass sie sich den Menschen gegenüber offiziell als neutral darstellen muss. Es wurden keine Sanktionen gegen Russland oder dergleichen verhängt. Aber in Wirklichkeit produziert Serbien Waffen für die Ukraine, weil die Regierung eine Kolonialregierung ist. Sie lässt Waffen mit den Zügen nach Serbien fahren und das alles wird vor der Bevölkerung verborgen. Viele Menschen, normale Menschen, glauben den Medien. Sie sagen: „Oh, wir sind wirklich neutral.“ Dann ist es unsere Aufgabe als Linke, als Antikriegsbewegung, den Leuten zu sagen: „Leute, wir sind nicht neutral. Wir sind in der NATO und arbeiten für die NATO. Es wird nur vor euch versteckt.“
Marko: Wir müssen auch gegen die Vorstellung ankämpfen, dass wir die einzigen Opfer des Imperialismus sind, dass dieser in Serbien absichtlich präsent sei. Diese Art Verfolgungskomplex oder Opferkomplex ist ein Narrativ, das Rechte um den Bombenanschlag der NATO herum schaffen – dass die Welt uns hasst, weil wir Serben sind. Wenn man jemanden wie Trump hat, der jetzt auf eine eher rechtspopulistische Art und Weise spricht, fördern viele Serben in der Regierung diese Wahrnehmung. Sie fangen an zu glauben, dass dies vielleicht die Situation für Serbien selbst ändern könnte. Sie glauben, dass Trump oder die USA den Kosovo an Serbien zurückgeben könnten oder etwas Ähnliches.
Das ist etwas, das von der Regierung konstruiert wird, die in Wirklichkeit die NATO unterstützt, Waffen an die Ukraine schickt, Waffen an Israel schickt und so weiter. Es ist also wichtig, ein anderes Narrativ zu schaffen, das die internationale Solidarität in einem umfassenderen Sinne einbezieht, um den Menschen in Serbien klar zu machen, dass es nicht nur um den Hass der NATO auf die Serben geht. Es geht eigentlich um einen globalen Kampf für Souveränität, für Selbstbestimmung, und dass wir uns der NATO nicht nur aufgrund unserer geopolitischen Interessen widersetzen müssen, sondern dass wir uns widersetzen müssen, um einen Raum für uns selbst zu schaffen, in dem wir normal leben können, um die Arbeiterklasse gegen die globale kapitalistische Ausbeutung zu verteidigen.
Wie sind die rechten Kräfte in Serbien aufgestellt und was sind eure antifaschistischen Strategien zu diesem Thema?
Ratibor: Nun, ich bin jetzt ein alter Mann, aber als ich jünger war, waren wir in der antifaschistischen Bewegung. Es gibt auch jetzt immer noch antifaschistische Gruppen in Serbien. Aber meine persönliche Sicht ist, dass der Antifaschismus zunächst einmal den Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien erlebt hat. 99% der serbischen Bevölkerung fühlen sich also als Antifaschist:innen. Es ist wirklich schwer, herumzulaufen und zu sagen: „Ich bin ein Faschist“. Dafür wirst du umgebracht von ganz normalen Leuten, deren Vater von den Nazis umgebracht wurde. Und weil wir keine nationale Bourgeoisie haben, haben wir auch keine wirkliche Nazibewegung in einer faschistischen Bewegung, weil sie die nationale Bourgeoisie brauchen, um sich zu etablieren. Die gesamte existierende faschistische Bewegung ist eine hauptsächlich subkulturelle Bewegung und wird von der Polizei kontrolliert. Antifaschismus ist eine Frage der Straße und wir müssen sie auf der Straße mit Gewalt angehen. Aber ich denke nicht, dass wir eine spezielle Politik des Antifaschismus in Serbien schaffen müssen, sondern Antifaschismus ein integraler Bestandteil der gesamten linken Aktivitäten ist.
Marko: Ja, im Grunde schon, aber es ist auch wichtig, den Faschismus zu unterbinden, indem Menschen aus Arbeiter:innenfamilien abgeholt werden, die durch die Liberalisierung, die Privatisierung der Wirtschaft und so weiter ruiniert sind. In der liberalen antifaschistischen Bewegung in der Vergangenheit gab es die Tendenz, die Menschen zu verteufeln, die Arbeiter:inennklasse für die Kriege in den 90er Jahren verantwortlich zu machen und sie immer zu beschuldigen, nationalistisch und rückständig zu sein – anstatt über die Kriegsgewinner und die Politiker zu sprechen, die den Krieg begonnen und das Feuer geschürt haben, über die Intellektuellen, die Bürgerlichen. Wir müssen also für die Seelen der Unterschicht gegen den Faschismus kämpfen.
Wir versuchen also, uns nicht zu isolieren, die Menschen nicht pauschal zu verurteilen und uns in eine Position zu begeben, in der wir heiliger sind als sie und uns zu den politisch korrektesten Menschen in Serbien machen. Dabei verstehen wir, dass es Viele gibt, die rückwärtsgewandt sind, Viele, die konservative Positionen vertreten und wir versuchen, mit ihnen zu reden – über Klasse und über Imperialismus, denn viele dieser Faschisten versuchen, Argumente und Propaganda aus westlichen Ländern zu benutzen, um uns mit weißen Menschen in den USA oder Deutschland usw. zu vergleichen. Die westlichen Länder schüren Faschismus und versuchen diese Art von Anti-Migrations-Hysterie auch in Serbien zu verbreiten. Serbien hat nicht wirklich ein Problem mit Migrant:innen, insofern, als dass die Migrant:innen aus Serbien weiterziehen und in den Westen gehen wollen. Es ist also wichtig für uns, den Leuten zu erklären, dass wir als Weiße nicht in der gleichen Situation sind wie die Menschen in den USA und dass wir die weiße Vorherrschaft nicht in dieser Weise unterstützen sollten. Als Serben stehen wir global gesehen an einem anderen Platz als diese westlichen Länder, die den Faschismus schüren.
Und gegen Faschismus zu kämpfen bedeutet eben auch, sich gegen die globalen Mechanismen von Imperialismus, sozialer Spaltung und rechter Propaganda zu stellen!
Am 4. März kam es im serbischen Parlament in Belgrad zu Protesten der Opposition während einer Sitzung. Um eine Einordnung der Geschehnisse zu bekommen, haben wir nochmal zu Marko Kontakt aufgenommen.

Marko, Anfang März ging dieses Video durch die Medien. Abgeordnete der Opposition stürmten auf die Parlamentspräsidentin Ana Brnabić zu, im Parlament wurden Leuchtraketen, Rauchbomben und Blendgranaten abgefeuert, um das Parlament an der Arbeit zu hindern. Wie ist die Situation in Serbien aktuell? Wie ist das Verhältnis dieser Aktion zur Studierendenbewegung?
Marko: Dieser Kampf im Parlament wurde von der liberalen Opposition geführt. Sie versucht damit, relevant zu bleiben. Die Regierung sollte ein Gesetzespaket vorlegen, das die von den Studierenden geforderte Senkung der Studiengebühren enthielt, welche die Opposition als „unpolitisch“, „egoistisch“ und „korrumpierend für die Studierenden“ bezeichnet.
Sowohl die parlamentarische Opposition als auch die außerparlamentarischen, NGO-finanzierten Gruppen wurden durch die Studierendenbewegung an den Rand gedrängt. Diese hat öffentliche Erklärungen abgegeben, sich von all diesen Gruppen zu distanzieren.
Grundsätzlich sehen wir, dass die Studierendenbewegung weiter stark ist. Es gab eine große Prozession nach Niš, bei der Studierende Hunderte von Kilometern marschierten und im ganzen Land als Befreier empfangen wurden. Bedeutend sind auch die Austausche zwischen den Studierenden in Sandžak (der bosniakisch-muslimischen Region Serbiens) und dem Rest des Landes, die interreligiöse und interethnische Einheit zeigen. Wir werden sehen, wie die Bewegung auf diesen Vorfall im Parlament reagiert. Er fällt mit dem Aufruf zusammen, „den Druck zu erhöhen“, bis die Forderungen durchgesetzt werden, aber die Studierenden achten sehr darauf, keine Verbindung zu den Oppositionsparteien einzugehen.
Was waren die Konsequenzen dieses oppositionellen Protests? Wie wurde durch die Regierung auf den Vorfall reagiert?
Marko: Der Premierminister Vučević trat vor einem Monat zurück, aber formell muss das Parlament seinen Rücktritt noch bestätigen. Dies hätte jetzt geschehen sollen, wurde aber durch diesen Vorfall verhindert. Sobald der Rücktritt angenommen wird, müssen entweder Neuwahlen ausgerufen oder innerhalb von 30 Tagen ein neues Kabinett gewählt werden.
Der Kampf im Parlament soll laut der regierenden Partei dazu geführt haben, dass einer ihrer Abgeordneten in kritischem Zustand sei sowie die Schwangerschaft einer anderen Abgeordneten. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Lüge, aber auch wenn nicht, kann es als Vorwand genutzt werden, um die repressiven Maßnahmen zu eskalieren.
Was können wir weiter erwarten?
Marko: Was als Nächstes passiert, ist ungewiss. Für März sind weitere Proteste geplant, darunter Aufrufe zu einem massenhaften Boykott aller Geschäfte und zu Arbeitsniederlegungen, wo es möglich ist, sowie die Fortsetzung der Proteste am Samstag.
Fotos: priva, twitte CC
Weitere Anylsen, Interviews und Hintergrundartikel findet ihr hier.