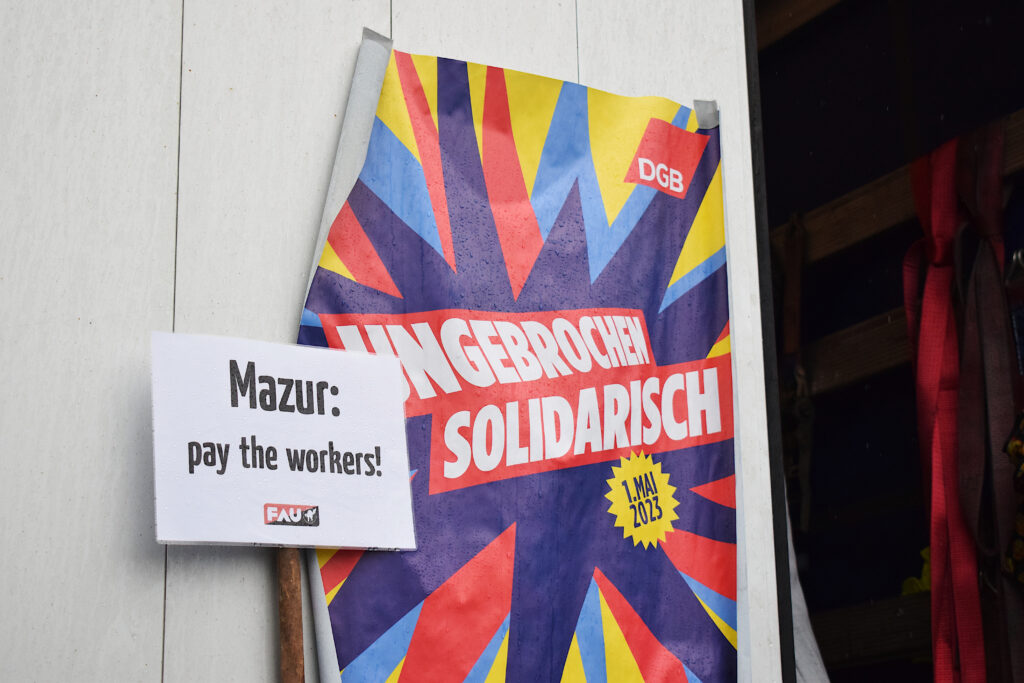Ein Gespräch von Rote Infos mit Richard und Felix, zwei Gewerkschaftern über die vom Bosch-Management angekündigte Schließung ihres Betriebes in Waiblingen bei Stuttgart, die Möglichkeiten und Grenzen gewerkschaftlichen Widerstands und die Rolle von Kommunist:innen in ihrer Organisierung.

Was produziert das Bosch-Werk in Waiblingen und warum soll es geschlossen werden?
Richard: Das Bosch-Werk in Waiblingen gibt es bereits seit vielen Jahrzehnten. In den besten Jahren haben hier einmal rund 2.500 Kolleginnen und Kollegen gearbeitet. Heute sind es nur noch knapp 600. Unser Produkt sind Kunststoffkomponenten und Stecker für die Autoindustrie. Früher haben wir aus Waiblingen die ganze Welt beliefert. Heute nicht mehr, denn es gibt seit einigen Jahren ein
vergleichbares Werk in Thailand.
Felix: Das Werk in Thailand wurde in den letzten Jahren mit dem Geld aufgebaut, was in Waiblingen für Neuinvestitionen, die Modernisierung der Anlagen und die Instandhaltung der Gebäude nötig
gewesen wäre. Und jetzt erzählt man uns, wir wären nicht mehr „wettbewerbsfähig“. Und das obwohl die Bosch-Manager die Substanz unseres Werks haben verkommen lassen und trotzdem noch Gewinne machten!
Richard: Noch ein Wort zur vermeintlich fehlenden „Wettbewerbsfähigkeit“. Für mich ist das ein politischer Kampfbegriff, mit dem mittlerweile viele Belegschaften in die Irre geführt werden. In Wirklichkeit geht es den Bossen darum, ihren gegen die Interessen großer Teile der Belegschaft ausgerichteten Strategie der Verlagerung in Billiglohnländer ohne oder mit nur sehr schwachen Gewerkschaften den Anschein eines „Sachzwangs“ zu verleihen. Mag sein, dass Profitmaximierung auf Kosten der Belegschaft im Kapitalismus ein „Sachzwang“ ist, aber dann ist der Kapitalismus das Problem.
Wie wehrt sich die Belegschaft dagegen?
Felix: Natürlich werden wir die Schließung des Werk nicht ohne Kampf akzeptieren. Wir wollen möglichst viele Arbeitsplätze in Waiblingen erhalten. Und wenn schon Kolleginnen und Kollegen gehen müssen, dann muss es für Bosch richtig teuer werden. So, dass man sich es beim nächsten Versuch etwas zu schließen oder zu verlagern vielleicht noch einmal überlegt. Insofern kämpfen wir nicht nur für uns, sondern auch für die Belegschaften anderer Werke und den Erhalt derer Jobs.
Richard: Natürlich werden wir nichts allein in Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung hinter verschlossenen Türen erreichen. Bisher wurde zum Beispiel jede Verhandlungsrunde durch
eine Aktion auf dem Werkgelände begleitet. Der vorläufige Höhepunkt war eine Demo unserer Gewerkschaft, der IG Metall, während der eigentlichen Arbeitszeit am 24.November durch Waiblingen. Wir hatten mit einigen hundert Teilnehmern gerechnet. Am Ende waren es dann fast 2.000! Darunter auch zahlreiche Delegationen aus den Betrieben der Region, aber auch aus entfernteren Bosch Standorten wie Hildesheim. So viel Solidarität tut gut, darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen mit einer Demo allein unsere Ziele noch lange nicht erreicht sind.
Wie laufen solche Verhandlungen ab?
Richard: Die angedrohte Schließung des Werks in Waiblingen steht ja nicht für sich. Sondern das Bosch Management hat angekündigt, zigtausende Jobs streichen oder verlagern zu wollen. Deshalb ist es
wichtig, dass sich die Belegschaften der einzelnen Standorte, so unterschiedlich sie und ihre Produkte auch sein mögen, nicht gegeneinander ausspielen lassen. Es wäre für uns sehr unsolidarisch, wenn man in einem anderen Standort auf einen Teil unseres „Geschäfts“ spekuliert, um die eigenen Jobs zu retten. Nach dem Motto: „Was schert mich Waiblingen, ich bin mir selbst der Nächste.“
Felix: Mir hat jemand „Wichtiges“ gesagt, jetzt müsse jeder für sich selbst verhandeln. Solidarität wäre gut, aber jetzt vorbei. Wir meinen allerdings, dass wir die Angriffe des Bosch-Managements nur dann abwehren können, wenn alle Belegschaften einen gemeinsamen Plan haben und gemeinsam zum Gegenangriff übergehen. Und wenn das Bosch-Management bei der Strategie des Unternehmens in den letzten Jahren Fehler gemacht haben sollte, dann sollen sie selbst dafür aufkommen! Sie verdienen doch genug. Es sind die Millionengehälter für Fehlentscheidungen, was in Wirklichkeit nicht mehr „wettbewerbsfähig“ ist!
Hat denn schon die Gewerkschaft zum Streik gegen die Werksschließung aufgerufen?
Richard: Eigentlich hätte das schon lange passieren müssen! Welchen Sinn macht es, zunächst den Betriebsrat, der nach deutschen Recht nicht zum Streik aufrufen darf, einen sogenannten
„Interessenausgleich und Sozialplan“ zu Ende verhandeln zu lassen, um dann nochmal dasselbe (nur in Besser) in Form eines sogenannten Sozialtarifvertrags zu fordern? Richtig wäre, spätestens jetzt die Verhandlungen des Betriebsrats mit der Forderung nach einem Sozialtarifvertrag zu „ergänzen“. Und erste Streikaktionen durchzuführen; so dass der maximale Druck auf das Bosch-Management entsteht, ihre Pläne Waiblingen zu schließen doch noch mal zu überdenken.
Felix: Kann sein, dass das jetzt Betriebsrats-Chinesisch war? Ich erkläre es nochmal.
In Deutschland gibt es seit der Novemberrevolution von 1918 Betriebsräte, die später von der Sozialdemokratie einen rechtlichen Rahmen erhalten haben; allerdings um sie einzuhegen und sowas wie „Revolution“ gar nichts erst aufkommen zu lassen. Heute heißt dieser Rahmen „Betriebsverfassungsgesetz“. Da steht zum Beispiel drin, dass der Unternehmer im Prinzip mit seinem Eigentum machen kann, was er will. Er muss allerdings vorher mit dem Betriebsrat – sofern es einen gibt – über die Folgen seiner Entscheidungen und gegebenenfalls deren Abmilderung verhandeln. Das heißt für uns in Waiblingen ganz konkret: zu wann wird das Werk geschlossen? Wer muss gehen? Gibt es Alternativen zur Kündigung, wie zum Beispiel ein durch den Arbeitgeber bezuschusster früherer Renteneintritt? Und wenn es zu Kündigungen kommt, wie hoch sind dann die Abfindungen? Hier kommt dann die IG Metall ins Spiel. Während der Betriebsrat in solchen Verhandlungen keine allzu harten Druckmittel außer einem „Einigungsstelle“ genannten Schlichtungsverfahren besitzt, kann die Gewerkschaft einen sogenannten Sozialtarifvertrag fordern und wenn nötig dafür streiken.

Was könnten ihr mit der IG Metall im Rahmen eines Sozialtarifvertrags denn überhaupt fordern?
Felix: Zum Beispiel sehr hohe Abfindungen. Das dreifache eines Bruttomonatsgehalts pro Beschäftigtenjahr wäre da durchaus denkbar. Oder die Verschiebung der Betriebsschließung um viele Jahre. Oder andere Dinge, die zwar formell die angekündigte Werksschließung betriebsverfassungsrechtlich nicht in Frage stellen, aber so teuer machen, dass es sich trotz Niedriglöhnen woanders nicht mehr rechnet.
Alles Dinge, die selbst nach dem sehr eingeschränkten deutschen Streikrecht legal wären. Man muss es sich nur trauen und tun!
Aber warum ruft dann die Gewerkschaft nicht einfach zum Streik auf? Hat sie Angst, dass bei euch nicht alle mitmachen?
Richard: Das kann nicht sein. Bei uns sind mehr als Dreiviertel der Belegschaft Mitglied der IG Metall. In der Produktion fast alle. Nur in den Büros ist noch wenig „Potenzial“. Aber wir arbeiten daran.
Felix: Leider gibt es fast überall Leute, die zunächst erzählen „Gewerkschaft brauche ich nicht“ und „der Betriebsrat ist was für die, die sich die Hände bei der Arbeit schmutzig machen“. Aber wenn es dann mal brenzlig wird, dann hätten sie doch gerne, dass jemand die Kohlen für sie aus dem Feuer holt.
Richard: Am liebsten irgendein „starker Mann“. Aber den gibt´s nicht oder der ist scheiße! Das kennen wir ja aus der deutschen Geschichte.
Für uns ist unsere Gewerkschaft nicht so etwas wie eine Versicherung, sondern eine Kampforganisation. Auch wenn man sie manchmal daran erinnern muss. Das heißt, die Gewerkschaft sind zuallererst ihre Mitglieder im Betrieb! Nur müssen diese Mitglieder auch verstehen, dass sie sich um ihre Organisation auch kümmern müssen. Das heißt, sich regelmäßig zu informieren, zu Versammlungen gehen, dort seine Meinung sagen, für kämpferische Mehrheiten werben, Aufgaben übernehmen und so weiter. Leider tun das heute viel zu wenige. Stattdessen flüchtet man sich in das „private Glück“. Bis der Kapitalismus einen einholt. Hätten sich aber in den Jahren zuvor alle ein wenig mehr gekümmert und sich für die eigene Klassenorganisation interessiert, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen! Die Kapitalisten greifen ja gerne dann an, wenn wir schwach und schlecht organisiert sind.
Was ich sagen will: Die Mitglieder der IG Metall – und nicht nur die – müssen sich endlich bewegen. Und der von diesen Mitgliedern bezahlte und in weiten Teilen auch gewählte Hauptamtlichen-Apparat soll aufhören von der „Sozialpartnerschaft“ früherer Jahre zu träumen. Das ist ein für alle Mal vorbei! Seit die Kapitalisten keine Angst mehr vor dem Sozialismus haben, sind sie Jahr für Jahr weniger bereit soziale Zugeständnisse zu machen. Das ist die harte Realität. Das heißt, es gibt auf lange Sicht nur zwei Möglichkeiten:
Erstens, die schlechtere Möglichkeit: Die IG Metall wird zu so etwas wie einer Servicegesellschaft für die Betriebsräte aus großen Unternehmen und damit gesamtgesellschaftlich bedeutungslos.
Oder zweitens, die bessere Möglichkeit: Die IG Metall richtet die eigene Organisation neu aus und lernt wieder das Kämpfen. Was auch heißt, kein Anhängsel irgendeiner Partei oder gar einer Regierung zu sein! Allerdings ohne dass die Mitglieder dafür Druck machen, wird das nicht passieren!
Felix: Leider braucht man in Deutschland den „offiziellen“ Aufruf eines Gewerkschaftsvorstands, um streiken zu dürfen. Fehlt dieser Aufruf und eine Belegschaft entscheidet eigenständig – wenn sie zum Beispiel über etwas emört ist – zu streiken, ist das nach dem deutschen Arbeitsrecht illegal. Das heißt wer mitmacht, riskiert gekündigt zu werden. Wer das organisiert hat, kann verpflichtet werden, dem Kapitalisten Schadensersatz für die durch den Streik entgangenen Profite zu leisten. Das ist alles nicht schön. Und riskant. Aber wenn alle mitmachen… Es gab in Deutschland auch schon sogenannte „Wilde Streiks“, die etwas bewirkt haben.
Richard: Und weswegen gibt es noch mal Betriebsräte in Deutschland? Weil vorher die Arbeiter:innen eine Revolution probiert haben, die Novemberrevolution 1918. Vermutlich war auch das „illegal“. Manchmal macht es Sinn, den rechtlichen Rahmen zu überschreiten, um ein besseres Recht zu bekommen. So müsste es meiner Meinung nach auch beim aktuellen Streikrecht sein.
Wie unterstützen Kommunist:innen den Kampf gegen die Werksschließung?
Felix: Viele Linke haben leider den Bezug zum Betrieb und zur Arbeiterklasse verloren. Nicht wenige fühlen sich irgendwie auch ganz wohl in ihrem akademischen Milieu an der Uni. Und wenn sie dann doch mal arbeiten gehen (müssen), dann ist es ihnen zu mühsam ihre Kolleginnen und Kollegen von radikalen politischen Positionen zu überzeugen. Da müsste man ja argumentieren (können) und erfährt nicht selten Desinteresse oder sogar harten Widerspruch. Einfacher ist es da, sich mit in weiten Teilen Gleichgesinnten im „Sozialen Zentrum“ im Szenekiez zu treffen, sich gegenseitig zu bestätigen und dabei irgendwie links zu fühlen. Bis das Studium vorbei ist und man ins Kleinbürgertum abbiegt. Nur ist sowas nicht links, sondern genau das, wie sich die Kapitalisten vermeintlich „Linke“ wünschen: Mit sich selbst beschäftigt und ohne Einfluss in der Arbeiterklasse. Der Klasse, die als einzige die Macht hätte (!) den Kapitalismus zu stürzen und eine sozialere Gesellschaft jenseits von Ausbeutung und Krieg aufzubauen.
Allerdings haben wir in Waiblingen Glück: Dort gibt es Kommunisten. Sie haben uns bereits seit langem unterstützt, in den Tarifrunden der letzten Jahre. Und ganz besonders seit die Bosch-Bosse
bekannt gegeben haben, unser Werk schließen zu wollen. Sie haben zum Beispiel Transparente mit uns gemalt oder Parolen für die Demo am 24.11. geübt. Und wenn es zum Streik bei uns kommt dann bin ich mir sicher, dass sie auch da sein werden.
Noch besser wäre es jedoch, wir hätten noch weitere Kommunisten bei uns im Betrieb. Vielleicht wäre das eine Aufgabe für die inzwischen wieder recht zahlreichen roten Zirkel in ganz Deutschland.
Gefällt das allen bei euch im Betrieb, dass die Waiblinger Kommunisten euch unterstützen? Oder gibt es auch welche, die sich daran stören?
Richard: Ein Betrieb ist keine Insel der „politischen Korrektheit“ Leider gibt es auch bei uns Rechte oder Kollegen, die der AfD nahestehen. Dass denen die „Roten“ nicht gefallen, überrascht mich nicht.
Wichtig ist nur, dass die Rechten niemals die Meinungsführerschaft innerhalb einer Belegschaft bekommen. Und es uns im Kampf für den Erhalt unseres Werks gelingt, den ein oder anderen
politisch „Verirrten“ wieder zurückzuholen. Das heißt politisch aufzuklären und von fortschrittlichen Positionen zu überzeugen.

Felix: Von Rechten erwarte ich keinen Respekt und keine Gerechtigkeit. Von meinen Gewerkschaftskollegen aber schon. Deshalb gehen mir diese verbohrten SPDler, wie es sie in Baden-Württemberg noch in manchen Gewerkschaftsgliederungen gibt, unglaublich auf den Sack! Ich habe manchmal den Eindruck, denen ist die Nähe zu den Bossen oder irgendwelchen Regierungsheinis wichtiger als unser Prinzip der Einheitsgewerkschaft?
Es war eine Lehre aus dem Faschismus, dass sich die Gewerkschaftsbewegung nicht mehr in verschiedene politische Lager spalten soll, solange man die Kapitalisten als gemeinsamen Gegner betrachtet. Das darf jedoch kein Lippenbekenntnis oder nur etwas für Sonntagsreden sein, sondern muss wieder Praxis werden.
Noch eine Frage zum Schluss – wie wird der Kampf bei Bosch in Waiblingen ausgehen?
Richard: Ich bin nicht naiv. Die Chance, dass das Bosch-Management seine Pläne, das Waiblinger Werk zu schließen, fallen lässt, ist gering. Weil wenn es uns als kleinsten Standort des ganzen Bosch-Konzerns in Deutschland gelingt, eine einmal getroffene unternehmerische Entscheidung umzukehren, dann kann das auch jede andere Belegschaft erkämpfen. Das werden die Bosse ums Verrecken zu verhindern versuchen. Wäre es doch das faktische Infragestellen ihres Rechts am Eigentum. Es geht also bei uns auch ums Prinzip. Und die Frage welche Klasse mächtiger ist.
Wir wissen natürlich, wo die Grenzen des gewerkschaftlichen Kampfs sind. Die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse in ganz Deutschland werden wir nicht durch die Revolution in Waiblingen allein aufheben. Aber wir können durch unseren Kampf dazu beitrage, dass wieder eine Partei entsteht, die in der Lage ist, die Arbeiterklasse im Kampf für den Sozialismus zu führen.
Felix: Realistisch ist, dass Bosch am Ende sehr viel Geld für sehr, sehr hohe Abfindungen auf den Tisch legt. Und die meisten Kolleginnen und Kollegen sagen werden, lasst uns die Kohle nehmen.
Und möglicherweise werden auch einige Jobs auch erhalten bleiben und nicht nach Thailand verlagert. Aber vermutlich nicht alle. Insofern sind wir realistisch und kämpfen neben „Geld“ auch um unseren Stolz als Arbeiter und Gewerkschafter.
Richard: Aber wer weiß, vielleicht schreiben wir in Waiblingen ja Geschichte? Und wenn nicht, dann haben wir es wenigstens versucht!

(Stand 30. Dezember 2025)
Fotos: Rote Infos